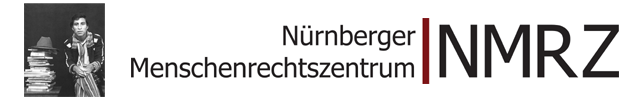Die Bedeutung und Umsetzung einer Opferorientierung in den Vertragsausschüssen der Vereinten Nationen
Was erwarten Opfer gravierender Menschenrechtsverletzungen, wenn sie sich an die verschiedenen Organe der Vereinten Nationen wenden, die über die Einhaltung der Menschenrechte wachen? Was können diese Organe tun, um die Interessen der Opfer bestmöglich in ihrer Arbeit zu berücksichtigen? Welche Möglichkeiten haben Opfer, sich in die Arbeit dieser Organe einzubringen? Wo liegen die durch das Mandat dieser Organe gegebenen Grenzen der „Opferorientierung“, wie ein in letzter Zeit häufig gebrauchter Begriff lautet?

Dies waren einige der zentralen Fragen der internationalen Fachkonferenz, die das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) zusammen mit dem Nürnberger Menschenrechtszentrum (NMRZ) am 29. und 30. September in Berlin durchführte. Die Initiative dazu war vom jüngsten Vertragsorgan der Vereinten Nationen, dem Ausschuss gegen das gewaltsame Verschwindenlassen, ausgegangen. Dieser überprüft die Erfüllung der Staatenpflichten, die sich aus dem Ende 2010 in Kraft getretenen Internationalen Abkommen gegen das Verschwindenlassen ergeben. An der Berliner Konferenz nahmen Vertreterinnen und Vertreter von Vertragsausschüssen, unabhängige Fachleute und Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika teil. Ergänzend brachten Mitarbeitende zweier internationaler Strafgerichtshöfe ihre Erfahrungen zur Rolle von Opfern bei solchen Gerichtsverfahren ein.
Ein Blick zurück auf den Umgang der Vereinten Nationen mit Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen, machte deutlich, dass seit 1946 viel erreicht worden ist. Lange Zeit war die Stimme der Opfer aus den Beratungen und Entscheidungen ausgeschlossen. In den siebziger Jahren begann die damalige UN-Menschenrechtskommission, die Vorgängerin des heutigen Menschenrechtsrates, vor allem mit der Berufung von Sonderberichterstattern beziehungsweise Arbeitsgruppen, den Opfern von Menschenrechtsverletzungen Gelegenheit zu geben, ihre Beschwerden direkt vorzubringen. Diese „Sonderverfahren“ veröffentlichen Berichte, in denen sie die verantwortliche Regierung auffordern, Abhilfe zu schaffen. „Die Vereinten Nationen wurden zu einem Ort, wohin wir uns wenden konnten, wo man uns anhörte, wo man uns verstand“, beschrieb beispielweise die Präsidentin der „Großmütter der Plaza de Mayo“, Estela de Carlotto, ihre damalige Erfahrung.
Rainer Huhle, Mitglied im UN-Ausschuss gegen das gewaltsame Verschwindenlassen, führte in die historische Entwicklung der „Opferorientierung“ bei den Vereinten Nationen ein. Mit der Einrichtung des freiwilligen Fonds für Folteropfer Anfang der achtziger Jahre und weiterer Fonds, und vor allem durch die Etablierung von Eilaktionen bei einigen Vertragsausschüssen und Sonderverfahren hätten sich die Vereinten Nationen inzwischen auch um konkrete humanitäre Hilfeleistungen bemüht. Auf der normativen Ebene seien mit den „van Boven-Prinzipien“ über die Rechte von Opfern auf Schutz und Wiedergutmachung sowie mit den „Joinet-Prinzipien“ gegen Straflosigkeit in den neunziger Jahren wesentliche Grundsätze der Rechte von Opfern festgeschrieben worden, die auch in die Texte und Interpretationen der Konventionen eingeflossen sind. In jüngster Zeit sei dazu das Mandat des „Sonderberichterstatters zur Förderung von Wahrheit, Gerechtigkeit, Rehabilitierung und Garantie der Nichtwiederholung“ gekommen.
Die Teilnehmenden der Konferenz würdigten diese Entwicklungen, benannten aber auch viele Defizite, die vor allem in der Praxis der Verfahren liegen: Betroffene finden oft nur sehr schwer Zugang zu den Möglichkeiten, die das UN-Schutzsystem bietet. Es kommt zudem auch immer noch vor, dass die Opfer die erlittenen Menschenrechtsverletzungen beweisen müssen, was oftmals kaum möglich ist. So lässt sich beispielsweise schwer nachweisen, wer eine Person entführt hat – staatliche Sicherheitsdienste oder Paramilitärs – oder ob Gefangene gefoltert werden. Hier müssten die Staaten stärker in die Pflicht genommen werden nachzuweisen, welche Schutzmaßnahmen sie ergriffen haben oder wie der Gesundheitszustand eines Gefangenen ist.
Die Möglichkeiten des Schutzsystems müssten insgesamt besser und breiter erläutert werden, so die einhellige Meinung der Expertinnen und Experten. Weiter wurde bemängelt, dass es an einer Willkommenskultur bei den Vereinten Nationen fehle, die auf die schwierige Lage derer eingeht, die Recht und Schutz suchen. Sprachschwierigkeiten, kulturelle Prägungen sowie die spezifischen Belastungen aufgrund der erlebten Menschenrechtsverletzungen stellten dabei große Herausforderungen dar. Hier müssten alle Mitarbeitenden des Hochkommissariats und auch die in den UN-Organen arbeitenden Sachverständigen besser geschult werden, so das Fazit. Aber auch den Nichtregierungsorganisationen, die oft als Bindeglied zwischen den direkten Opfern und den UN-Organen fungierten, kommt dabei eine bedeutende Rolle zu.
Ein wichtiges Instrument des Menschenrechtsschutzes ist auch, dass die verschiedenen UN-Organe von den Regierungen Maßnahmen zum Schutz bedrohter Menschen verlangen können. Die Wirksamkeit solcher Schutzmaßnahmen wurde auf der Konferenz sehr unterschiedlich eingeschätzt. Einigkeit bestand aber, dass sie jedenfalls viel genauer beschrieben und mit den Betroffenen selbst ausgehandelt werden müssten, damit sie nicht selbst die Rechte der Betroffenen einschränken oder gar zu neuen Gefahrenquellen werden. So kann beispielsweise die Anordnung von Personenschutz für einen Betroffenen dazu führen, dass der Staat genaues Wissen über dessen Aktivitäten und Kontakte erhält und damit politische Arbeit von Regimekritikern überwachen und behindern kann.
Als ein wachsendes Problem in den vergangenen Jahren wurden die Repressalien einiger Staaten gegen Beschwerdeführende, Anwälte und Anwältinnen oder Zeugen und Zeuginnen, die mit den Vereinten Nationen zusammen arbeiten, genannt. Insbesondere bei Länderbesuchen von Sonderberichterstattern und sogar in den Gebäuden der Vereinten Nationenin Genf sei es immer wieder zu massiven Bedrohungen gekommen. Zwar habe der UN-Generalsekretär das Problem erkannt und ihm hohe Priorität eingeräumt, doch an der Umsetzung von konkreten Maßnahmen zum Schutz dieser Personen fehle es noch. Denn es sei klar, dass der Menschenrechtsschutz der UN nicht funktionieren könne, wenn die daran Beteiligten nicht selbst geschützt würden.
Als ein zentrales Anliegen der Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen wurde häufig das Recht auf Garantien hervorgehoben, dass sich diese Verletzungen nicht wiederholen. Dieses Recht erweist sich als besonders schwierig, weil es sich nicht mit einzelnen Maßnahmen verwirklichen lässt, sondern letztlich auf umfassende politische Weichenstellungen verweist.
Gefragt, was die dringlichste Forderung der Opferseite sei, antwortete eine Menschenrechtsanwältin: Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, und noch einmal Gerechtigkeit. Auch Psychotherapeutinnen bestätigten, dass ohne die Anerkennung des erfahrenen Unrechts die Heilung der seelischen Wunden kaum möglich sei.
Solche Überlegungen führten zu der Frage, die sich durch die ganze Konferenz zog: Ist die Rede von „Opfern“ angemessen? Reduziert sie nicht die Menschen, deren Menschenrechte verletzt werden, auf eine Opferrolle? Denn dadurch werde ausgeblendet, dass diese Menschen ein Leben vor und nach diesen Verletzungen haben, dass sie nicht als Bittsteller, sondern als Träger von Rechten, nicht als Objekt von Hilfsmaßnahmen, sondern als Personen angesprochen und anerkannt werden müssen.
Autor: Rainer Huhle