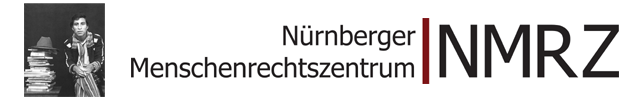von Otto Böhm
Unter Menschenrechtsgesichtspunkten war der völkerrechtlich gradlinige Weg vom Nürnberger Militärtribunal (IMT) zum in Rom beschlossenen Ständigen Internationalen Strafgerichtshof (ICC) widersprüchlich und kurvenreich. Das will ich hier mit einem kurzen Rückblick auf Nürnberg und auf den Ad-hoc-Gerichtshof zu Ex-Jugoslawien sowie mit einem Seitenblick auf die Russell-Tribunale der sechziger und siebziger Jahre zeigen. Damit soll zugleich eine Antwort auf die Frage des Jahrbuch-Schwerpunktes nach dem Beitrag internationaler Tribunale zur Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen gegeben werden. Unter Aufarbeitung verstehe ich zuerst die politisch-rechtliche Lösung eines vergangenen Konfliktes, der mit massiven Menschenrechtsverletzungen verbunden war und der Täter und Opfer hinterlassen hat. Die Verfolgung der Täter und die Rehabilitierung der Opfer heilt noch nicht die gesellschaftlichen Wunden; dazu bedarf es sozialer, kognitiver und individueller Lernprozesse, bedarf es der politischen Bildungsarbeit in der gesamten Gesellschaft. Adorno hat in seinem bekannten Aufsatz „Was heißt Aufarbeitung der Vergangenheit?“ 1959 diese zweite Dimension entfaltet und auf den Konflikt zwischen Aufarbeitung als dem Fortgang des politischen Geschäftes und, dem entgegenstehend, der notwendigen Erinnerung, hingewiesen. Seine Überlegungen beziehen sich auf die deutsche Problematik, bleiben also im nationalen Rahmen. Der Raum der Nationalgeschichte und des kollektiven Bewußtseins ist wohl auch noch der zentrale Zusammenhang zur Aufarbeitung von Kollektivverbrechen.
Internationale Tribunale sind dagegen auf einer transnationalen Ebene angesiedelt, ihr Ziel ist nicht zuerst die Aufarbeitung von Verbrechen im Sinne von Erinnerung als schwierigem Bestandteil der nationalen politischen Kultur, sondern die völkerstrafrechtliche Ahndung.
Widerspricht dem nicht das, was unter dem Begriff „Weltgesellschaft“ (Tetzlaff, 279) verstanden wird? Zwar gibt es erst ansatzweise einen der nationalen Öffentlichkeit analogen Kommunikationsraum im Sinne eines kollektiven Gedächtnisses auf transnationaler Ebene. Die Menschenrechtsarbeit muß aber von der Weltgesellschaft als Erinnerungsraum, wenn auch nur kontrafaktisch, ausgehen. Wir sprechen schon von internationaler Gemeinschaft und Weltzivilisation, die Kommunikation verdichtet sich, die Strukturen der internationalen Zusammenarbeit sind stabil und bringen neue internationale Regime zur Regulierung von Konflikten hervor, wir befinden uns „auf dem Weg zu einer internationalen Zivilgesellschaft“ (Kößler, 305ff.) mit den „Menschenrechten als regulativer Idee“ (Tetzlaff, 279). In dieser Weltgesellschaft werden die Konflikte zwischen universellen moralischen Normen, ihrer rechtlichen Setzung und ihrer tatsächlichen Durchsetzung ausgetragen. Ein bedeutender Akteur ist hierbei die internationale Menschenrechtsbewegung geworden. Sie trägt dazu bei, auch in der internationalen Politik die Grenze zwischen Politik und Verbrechen zu markieren. Das systematische Überschreiten dieser Grenze durch staatliche Politik oder regional herrschende Eliten, also Politik als Verbrechen, ist ein völkerstrafrechtlicher Tatbestand geworden, die effektive Strafverfolgung ein internationales Politikum ersten Ranges. Diese Entwicklung begann mit den sogenannten Nürnberger Prozessen und hat im Beschluß von Rom, einen Ständigen Internationalen Strafgerichtshof zu installieren, ihren vorläufigen Abschluß gefunden.
Das Internationale Militärtribunal (IMT) 1945 in Nürnberg
Mit dem Londoner Abkommen vom 8. August 1945 richteten die Alliierten das Nürnberger Militärtribunal ein. Ihre Entscheidung für ein Gerichtsverfahren hatte u.a. zum Ziel, mit einem ordentlichen Strafgericht dauerhafte internationale Rechtsstandards zu etablieren. Diese normsetzende Wirkung des IMT ist heute in der Bedeutung der sogenannten „Nürnberger Prinzipien“, der Trias der Anklagepunkte von 1945 (Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit) festzustellen. Besonders zwei Rechtsnormen des Prozesses sind für die Weltöffentlichkeit heute weitgehend Konsens: Handeln auf höheren Befehl kann kein juristischer Rechtfertigungsgrund sein und eine Staats- oder Kollektivhaftung kann es strafrechtlich nicht geben. Insgesamt „bedeutete Nürnberg den Versuch, mit der Idee ernst zu machen, daß bestimmte Verbrechen nicht mit dem Hinweis, es handele sich um Politik, exkulpiert werden können. Solche Verbrechen sollten zu Verbrechen im rechtlichen Sinne erklärt und – unter Hintanstellung staatlicher Souveränität – verfolgt werden können“ (J. Ph. Reemtsma, Frankfurter Rundschau vom 15.Januar1996).
Drei Einwände haben die Wirkung des Militärtribunals als Modell im Sinne einer Aufarbeitung beeinträchtigt (ich vernachlässige hier die menschenrechtlich indiskutable Todesstrafe). Sie spielen in der Diskussion über die Legitimität des IMT immer noch eine zentrale Rolle und in ihnen vermischen sich juristische und moralische Kriterien auf schwer entwirrbare Weise: a) das Verhältnis der Anklagepunkte Verbrechen gegen den Frieden/Führen eines Angriffskrieges und Verbrechen gegen die Menschlichkeit; b) das Rückwirkungsverbot; und c) das Gebot des gleichen Maßstabes für alle (tu quoque-Prinzip).
Zu a): Hier blockieren sich auch oft in der Menschenrechtsbewegung das Bemühen um juristische Korrektheit und moralische Entschiedenheit gegenseitig. Kriegsverbrechen waren nach dem Rotkreuz-Abkommen und nach der Haager Landkriegsordnung klar definierbar, auch der Angriffskrieg war nach dem Briand-Kellog-Pakt klar bestimmt – Abkommen, die Deutschland unterschrieben und nicht gekündigt hatte. Folgerichtig wurden auch die meisten Angeklagten wegen dieser Punkte verurteilt, jedoch zu vergleichsweise geringen Strafen in Relation zu den systematischen Vernichtungsverbrechen im Osten. Das Gericht „war nicht vom Höchstrang des Angriffskrieges auf der Skala makrokrimineller Verwerflichkeit wirklich überzeugt“ (Merkel, 83).
Zu b): Die härtesten Strafen, also Todesurteile, wurden gegenüber Angeklagten ausgesprochen, denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachgewiesen wurden. Dieser Anklagepunkt war in rein juristischem Sinne Neuland, eine Verurteilung somit ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot. Dazu hätten sich, so Reemtsma, die Richter auch bekennen sollen. In seiner Argumentation formuliert er eine klare Lösung des Dilemmas: „Das Rückwirkungsverbot dient dem Schutz des Einzelnen, seiner Rechtssicherheit. Er sollte sich darauf verlassen können, nicht wegen einer Tat bestraft zu werden, die nicht strafbar war, als er sie beging. Er muß die Chance haben, sagen zu können: “šWäre meine Tat damals strafbar gewesen, ich hätte sie nicht begangen.“˜ Im Falle von Verbrechen vom Ausmaß der in Nürnberg verhandelten wäre eine solche Redeweise undenkbar. Eine Selbstverteidigung der Angeklagten, die etwa in der Behauptung bestanden hätte, man hätte den Massenmord an den europäischen Juden unterlassen, wenn er strafbar gewesen sei oder für strafbar erklärt worden wäre, ist eine so absurde Vorstellung, daß nicht einmal die Angeklagten auf sie verfallen wären“ (J. Ph. Reemtsma, Frankfurter Rundschau vom 15. Januar 1996).
Zu c): Emphatisch wurde das IMT als ein Hauch des Weltgewissens bezeichnet. Seine Wirkung wurde verringert dadurch, daß die Mächte, die die Nachkriegsordnung prägten und Richter sowie Ankläger stellten, sich den Nürnberger Prinzipien in späteren Jahren in ihren eigenen Ländern selbst nicht konsequent unterwarfen. Ohne die politisch-moralische Dimension einzelner Verbrechen der Nachkriegszeit mit dem Nationalsozialismus vergleichen zu wollen: Zu viele Staaten, allen voran Sicherheitsratsmitglieder, könnten wegen ihrer seit 1945 begangenen Verbrechen angeklagt werden. Und auch mit Dresden oder Hiroshima hätten sich internationale Gerichte befassen sollen, auch wenn diese Forderung häufig auch dem durch das IMT gekränkten kollektiven Narzismus vieler Deutscher entspringt. Das rechtliche tu quoque, also das Messen mit gleichen Maßstäben, ist nicht nur ein unumstößliches Rechtsprinzip, sondern auch ein Desiderat der internationalen politischen Moral (zum Problem der Selektivität noch einmal unter Punkt Ex-Jugoslawien).
Fazit: Der Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen hat das Internationale Militärtribunal, soweit es nicht als Siegerjustiz diskreditiert wurde, gedient, weil es mit der Beweisaufnahme historische Tatsachen ans Licht gebracht hat, die die Politik entzaubert haben und als Verbrechen dastehen ließen.
Meinungstribunale als Instanzen eines moralischen Internationalismus
Die Meinungstribunale ohne Strafrechtscharakter (Russell-Tribunale) in der Nachkriegszeit hatten eine weltweite Bedeutung für das internationale Bewußtsein über Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zeigen aber auch die Spannung zwischen Recht und Moral. „Die Enttäuschung der Öffentlichkeit angesichts dieses bisherigen Mißerfolges [des Ausbleibens eines Internationalen Strafgerichtshofes nach dem IMT – O.B.] führte zur Schaffung sogenannter Tribunals of Opinion, die ohne jegliche offizielle Machtausstattung versuchen, einen neuen Weg zu beschreiten und nicht dort haltzumachen, wo die offizielle Rechtsprechung die Grenzen ihres Handelns findet oder zieht“ (Rigaux, 154). Der Grundtenor der von den Tribunalen gefällten Urteile kann heute vielfach als moralischer common sense gelten (z.B. über den Vietnam-Krieg oder Diktatoren wie Marcos und Duvalier).
Im Einzelnen arbeiteten die nicht unumstrittenen Tribunals of Opinion ohne jede Machtausstattung. Sie verurteilten auch keine Einzelpersonen, ihnen ging es um grundlegende Fragen der internationalen Politik. Das Internationale Tribunal über die Kriegsverbrechen der USA in Vietnam 1967/68 (Russell-Tribunal I) stellte fest, daß der Krieg der USA nicht mit der Charta der Vereinten Nationen (UN) im Einklang stand und im Rahmen dieses Krieges gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen wurde. Zu den Repressionsverbrechen in Lateinamerika wurde 1974-76 das Russell-Tribunal II in drei Teilen durchgeführt: Anhörung der Zeugen, Aufdecken des Zusammenhangs Militärregime sowie wirtschaftliche Ausbeutung und Einfluß des internationalen Kapitals. 1979 wurde das Ständige Tribunal der Völker in Bologna gegründet. Seine Anklagepunkte waren die Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht in Afghanistan, im Westsahara-Konflikt, in Eritrea und in Osttimor. Neben der UN-Charta und dem Kriegsvölkerrecht waren die UN-Dekolonialisierungs-Resolution und die Völkermordkonvention die Bewertungsmaßstäbe des Tribunals. Weiter wurden Fragen der Selbstbestimmung der Völker und die Verschuldung der Dritten Welt behandelt. Der deutliche antiimperialistische Impuls ist dem Ausgangspunkt Vietnam-Krieg als Ausdruck der epochalen Nord-Süd-Konfrontation geschuldet, in dem ein militärischer Sieg des Südens die dennoch weiterhin stärker werdende Abhängigkeit nicht verringern konnte. Die weltwirtschaftliche Konstellation, gestützt durch politische und militärische Hegemonie, wurde als Problem der Freiheit/Abhängigkeit von Völkern begriffen und der Politik der westlichen Demokratien moralisch zugerechnet. Diese einseitige Interpretation von Menschenrechten als Völker-Rechten ließ die Menschenrechtsverbrechen sozialistischer Staaten und die Unterdrückungsmaßnahmen junger Befreiungsbewegungen unterbelichtet.
Rigaux resümiert die Rolle und die Prinzipien der finanziell und politisch unabhängigen Russell-Tribunale und des Ständigen Tribunals der Völker: Sie müssen „eine Ersatz- bzw. Komplementärfunktion erfüllen, wenn ein internationales bzw. nationales Gericht nicht in der Lage war oder ist, eine Entscheidung zu fällen, die der Gerechtigkeit Genüge tut“ (Rigaux, 163). Da eine klare Trennung zwischen Politik, Recht und Moral in diesen Verfahren nicht angestrebt wurde, konnten sie auch leider dem folgenden anspruchsvollen Ziel dienen: „Menschen und Völker müssen ihre Vergangenheit annehmen, und bewältigen, was auf Opfer und Täter gleichermaßen zutrifft. Vergeben heißt nicht vergessen, verdrängte Schuld trägt sich nicht leichter als der Schrecken erfahrenen Leids“ (ebd., 164).
Die Nicht-Verfolgung von Menschenrechtsverbrechen im Rahmen nationaler Gerichtsverfahren besonders in Lateinamerika wurde Thema des Ständigen Tribunals der Völker im April 1991, das unter dem Titel „Prozeß gegen die Straflosigkeit von Menschenrechtsverbrechen in Lateinamerika“ stattfand. Die systematischen Mechanismen der (Selbst-) Amnestierung von Verbrechen gegen wirkliche oder vermeintliche, bewaffnete oder nicht-bewaffnete Oppositionsgruppen im Lateinamerika der siebziger und beginnenden achtziger Jahre waren nicht durch ein autorisiertes Gericht, sondern durch die Autorität und das internationale Ansehen von Persönlichkeiten wie dem italienischen Philosophen Guilio Girardi oder dem argentinischen Friedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquivel angeklagt. Die Auffassung, von der das Gericht geprägt war, wurde inzwischen zum Konsens der internationalen demokratischen Weltöffentlichkeit: Den Normen des humanitären Rechts (z.B. der Konvention gegen Folter) müssen konsequenterweise internationale Sanktionen auch unabhängig vom Prinzip der territorialen Zuständigkeit folgen. Das Tribunal von Bogotá bezog daraus seine Legitimität: „Da die nationalen Regierungen und die internationalen Organisationen des Menschenrechtsschutzes weithin versagen, dieser andererseits längst international verbindlich ist, kann auch ein diplomatisch nicht anerkanntes Gremium wie das internationale Tribunal, sofern es sich auf diese Prinzipien internationalen Rechts stützt, legitimerweise in Aktion treten“ (R. Huhle, epd-Entwicklungspolitik-Materialien 9/II, 44).
Ein Tribunal wie das in Bogotá konnte sich die Freiheit nehmen, politisch-gesellschaftliche Mechanismen zu analysieren, die die öffentliche und strafrechtliche Thematisierung von Menschenrechtsmechanismen verhindern. Huhle faßt sie in folgenden sechs Punkten zusammen.
1) „Die Justiz, im Rechtsstaat die Instanz, die aufgerufen ist, gerade auch die Verstöße des Staates selbst zu ahnden, macht sich häufig selbst zum Werkzeug der Diktatoren. Willfährige Richter und das überall bestehende System der Sonderjustiz für Polizei und Militär verhindern, daß Recht gesprochen wird.
2) Spezielle Untersuchungskommissionen für Menschenrechtsverletzungen haben sich häufig als Mittel der Vertuschung und Verzögerung der Wahrheitsfindung erwiesen.
3) Mit gewichtigen Ausnahmen spielen auch die Massenmedien bei der Vertuschung, Verharmlosung oder gar Rechtfertigung von Menschenrechtsverbrechen mit.
4) Amnestien sollen das Vergessen fördern und die Vergangenheit ungeschehen machen. Moralisch besonders verwerflich und juristisch skandalös sind die Selbstamnestien, mit denen sich eine Reihe von Militärdiktaturen reinzuwaschen suchte.
5) Das Fortbestehen der Ideologie der Nationalen Sicherheit in den Streitkräften auch unter demokratisch gewählten Regierungen und ihre Wirksamkeit unter Teilen der Bevölkerung führt zu anhaltender Akzeptanz von Menschenrechtsverletzungen und verhindert Sanktionierung.
6) Ein geringes Niveau an gesellschaftlich praktizierter Demokratie und an Partizipationsmöglichkeiten von Basisorganisationen läßt entsprechend viel Spielraum für straflose Menschenrechtsverletzungen. Diese wiederum – ein circulus vitiosus – beschneiden den Spielraum der demokratischen Bewegungen weiter“ (ebd,. 48f.).
Die ausführliche Analyse dieser Mechanismen kann nicht das Ziel eines Ständigen Internationalen Strafgerichtshofes sein. Andererseits schwindet mit dieser notwendigen Engführung auf strafrechtliche Präzision auf dem Weg von Nürnberg nach Rom auch die aufklärerische Kraft bezüglich der gesellschaftlichen Mechanismen, die zu Folter, Verschwindenlassen usw. führen. Dieser Verlust kann am Beispiel des Türkei-Kurdistan-Konflikts ermessen werden: Es wird schwer zu bestreiten sein, daß es sich hier um einen Menschenrechtskonflikt mit internationaler Dimension handelt. Und es liegt nahe, nach der Zuständigkeit eines internationalen Strafgerichtshofs zu fragen. Andererseits ist offensichtlich, daß diese Zuständigkeit nicht einfach zu begründen und noch schwerer politisch durchsetzbar sein wird. Mögliche Verfahren könnten auch nur strafrechtliche Ergebnisse haben, ohne zu Erklärungen oder gar Lösungen des Konflikts beizutragen. Norman Paech hat schon auf der Nürnberger Menschenrechtstagung 1997 ein politisches Türkei-Tribunal gefordert. Mit einem Tribunal ohne Strafrechtscharakter wären die politisch-moralischen und die juristischen Dimensionen entkoppelt. Ohne diese Bindung wäre eine politische Analyse und gegebenenfalls Verurteilung der türkischen Politik möglich.
Der Ad-hoc-Gerichtshof zu Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht in Ex-Jugoslawien
Durch internationalen Druck konnte der UN-Sicherheitsrat 1993 dazu gebracht werden, den Internationalen Strafgerichtshof zu Ex-Jugoslawien einzurichten. Im Unterschied zur Konstruktion der Alliierten 1945 strebt der Sicherheitsrat mit seiner Entscheidung nicht primär die politisch-moralische Anklage von Menschenrechtsverbrechen einer Kriegspartei an. Er muß vielmehr, entsprechend der Konstruktion des Gerichts gemäß Artikel VII der UN-Charta, die Verfolgung von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht als Teil der Friedenssicherung darstellen. „Obwohl also vom Sicherheitsrat eine Bedrohung des Friedens zum Ausgangspunkt genommen wird, kann und darf der Gerichtshof in diesem Konflikt nicht Partei ergreifen“ (Goldstone, 61). In der Resolution 808 wird die Wiederherstellung und Wahrung des Friedens als Begründung für die Einsetzung des Gerichtshofes gegeben. Ohne Vorgehen gegen Menschenrechtsverbrechen im jugoslawischen Bürgerkrieg wäre zwar eine politische Lösung möglicherweise leichter zu erreichen gewesen, aber nicht eine dauerhafte Friedenssicherung auf der Basis von Wahrheit und Gerechtigkeit. Der ehemalige Chefankläger des Gerichtshofs, Richard Goldstone, weist darauf hin, daß der Sicherheitsrat den Strafgerichtshof durch die Hintertür, also nicht primär wegen der Notwendigkeit von Gerechtigkeit eingesetzt hat. Die Differenz zwischen dem Sicherheitsrat als Organ mit uneinheitlichen politischen Interessen und seinem Verständnis von Friedensgefährdung einerseits und dem Erfordernis der klaren Definition von Menschenrechtsverbrechen als Interventionsschwelle andererseits hat Reinhard Marx herausgearbeitet. Der Sicherheitsrat, zuständig für Friedenssicherung im Rahmen des nationalstaatlichen Systems, ebnet einem Gerichtshof den Weg für ein Vorgehen gegen Menschenrechtsverbrechen auch über die Grenzen eines Nationalstaats hinweg.
Das Internationale Tribunal nahm die Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen im Kriegsfalle ernst und bezog auch, ein neuer Tatbestand, die Vergewaltigung von bosnischen Frauen mit ein. „Unter der Leitung von Richard Goldstone wurde sexuelle Gewalt endlich als Kriegsverbrechen benannt und gewertet. Juristinnen in einem eigens dafür zuständigen Team sind um Aufklärung des Ausmaßes und der strategischen Dimension bemüht“ (Hauser, 52). Dies ist auch ein Ergebnis des Menschenrechtsverständnisses, wie es innerhalb der meisten Menschenrechtsgruppen inzwischen anerkannt ist: Vergewaltigungen sind keine Nebensache, sondern ein systematischer Bestandteil von Kriegen. Die Kriegsvergewaltigung muß wegen ihrer Einsetzung als strategisches Element der Kriegführung als politische Menschenrechtsverletzung bewertet werden. „Vergewaltigung bedeutet den schwerstmöglichen Angriff auf das intime Selbst. Die Opfer erleben und erleiden Todesängste, Panik, Ekel, Gefühle extremer Hilflosigkeit, tiefe Verzweiflung und existentielle Sinnlosigkeit. Die Gewalterfahrungen verursachen individuell verschieden schwere Traumatisierungen und bekannte Muster von kurz- und langfristigen körperlichen und seelischen Folgen“ (Hauser, 50). Für das Verfahren in Den Haag bedeutet dies, daß vergewaltigte Frauen als Zeuginnen mehr als andere Opfer berechtigte Angst haben, ihren Vergewaltigern wiederzubegegnen und nur begrenzt zur Verfügung stehen können.
Die Wirkung des Ad-hoc-Gerichtshofes in Den Haag im internationalen Bewußtsein hat Richard Goldstone folgendermaßen resümiert: Seine Einrichtung war ein wichtiger Schritt, „Millionen Menschen überall auf der Welt bewußt zu machen, daß es rechtliche Regulierungen der Kriegführung gibt“ (Goldstone, 66). Der Wertekonflikt Frieden versus Menschenrechtsschutz, der auch der Auseinandersetzung um die Legitimität des Krieges der NATO gegen Jugoslawien zugrunde liegt, wurde schon zu Beginn der Gerichtstätigkeit deutlich gesehen: „Das Hauptziel des Gerichtshofes ist es, den Frieden wiederherzustellen. Wenn auch nur geringe Aussichten darauf bestehen, die Konfliktparteien würden sich unter dem Druck der wirtschaftlichen Lage verhandlungsbereit finden, stünde das Gericht im Wege. Denn es soll die Hauptverantwortlichen aburteilen, mit denen möglicherweise Verhandlungen zu führen wären. Ist es zu verantworten, in einer solchen Lage das Gericht weiterarbeiten und an ihm die Verhandlungen scheitern zu lassen?“ (Partsch, 17).
Auch wenn die Gründung des Haager Tribunals gerade wegen seiner möglicherweise kurzfristig dysfunktionalen Wirkung im Friedensprozeß ein zivilisatorischer Fortschritt ist, bleibt sie auch ein Ausdruck historischer Selektivität. „Mal nur theoretisch: die Einrichtung eines Tribunals zu den anhaltenden Kriegsverbrechen Indonesiens in Ost-Timor wäre diskutiert worden. Dazu hätte es nicht den notwendigen Konsens gegeben. Da hätten sich auch die islamischen Länder, die sich damals im UNO-Sicherheitsrat für das UNO-Tribunal in Jugoslawien stark gemacht haben (nicht zuletzt deswegen, weil die Hauptopfer des Krieges eben Muslime waren), gesperrt. Oder eine Diskussion über ein Tribunal zu den Kriegsverbrechen Rußlands in Tschetschenien, die in einem Schweigekartell von Bonn bis Washington aus dem angeblich übergeordneten Interesse, Boris Jelzin den Rücken zu stärken, bis heute unter den Tisch gekehrt werden“ (Zumach, 20). Die Kritik an der Selektivität soll jedoch nicht den Schluß nahelegen, daß Tribunale nicht stattfinden sollen: „Aus der mit Sicherheit zutreffenden Annahme, daß weder wegen aller Verbrechen ermittelt, noch daß alle Verbrechen würden verurteilt werden können, folgt natürlich keineswegs die Notwendigkeit, gleich jedes Verbrechen ungeahndet zu lassen“ (J. Ph. Reemtsma, Frankfurter Rundschau vom 15. Januar 1996). Ob der zukünftige Ständige Internationale Strafgerichtshof diese Selektivität ausschließen kann, wird sich zeigen. Programmatisch und strafrechtlich muß er das zwar nicht zufällige, aber doch bestimmten historischen Umständen geschuldete Zustandekommen der bisherigen Gerichte durch ein systematisches, pflichtgemäßes und eben nicht-selektives Vorgehen ablösen. Damit werden jedoch die Momente der politischen Aufarbeitung, die immer auch stark an die konkreten Umstände gebunden sind, noch stärker aus den Verfahren verschwinden.
Fazit
Mit internationalen Tribunalen gewinnen wir ein Wissen über staatliche und parastaatliche Tätergruppen und lernen, kollektive Taten als Teilakte gesamtgesellschaftlicher Konflikte zu begreifen. Denn die einzelnen Täter verhalten sich „systemkonform und angepaßt innerhalb eines Organisationsgefüges, Machtapparates oder kollektiven Aktionszusammenhanges. [“¦] Verbrechen können nicht von isoliert handelnden Einzelnen oder Gruppen begangen werden, daß ist ein fundamentaler Unterschied zu sonstiger Kriminalität“ (Jäger, 327).
Das individuelle Verhalten ist von der gesellschaftlichen Makroebene abhängig, wird aber als strafrechtliche Schuld auf Personen bezogen. Insofern richten sich diese Verfahren immer gegen eine Kollektivschuldthese. Dem widerspricht nicht, daß Staaten häufig als Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen bezeichnet werden müssen und entsprechend widerstrebend auf internationale Untersuchungen reagieren.
In vielen Menschenrechtsgruppen wird die Bedeutung der Tribunale für die Opfer von Menschenrechtsverbrechen betont. Und mit dem Begriff Opfer sollen die Anstrengungen der Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen um die Wiedergewinnung ihrer Autonomie nicht verdeckt werden. Aber Gerechtigkeit in Gestalt der Verurteilung von Tätern, aber auch im zivilrechtlichen und gesellschaftspolitischen Sinne ist eine Frage der Anerkennung der Leiden der Opfer. Öffentliche Verfahren haben eine therapeutische Wirkung für die Gesellschaft und die Opfer. Richard Goldstone betont (in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung vom 5. August 1995), daß die offizielle Anerkennung der Leiden der Opfer Bestandteil ihres Heilungsprozesses ist: „Die Wahrheitsfindung auf dem Rechtsweg und die Feststellung der Wahrheit durch die Rechtsprechung als verbindlichster gesellschaftlicher Instanz ist für die Opfer und Täter von größter Relevanz.“
Zum Schluß noch die Frage nach einer möglichen Abschreckungsfunktion von internationalen Tribunalen. Bei den potentiellen Angeklagten steht vor der Angst vor einer Bestrafung die Angst vor einer Niederlage, und diese Angst kann sogar noch die Aktivitäten gegenüber Gegnern und Opfern steigern. Meist ist eine Strafverfolgung erst nach der völligen Niederlage oder der Veränderung der politischen Verhältnisse möglich. Z.B. wird es schwer nachweisbar sein, daß sich Einheiten der jugoslawischen Bundespolizei, die schon in Bosnien aktiv waren, sich von Vertreibung, Selektion und Mord im Kosovo haben abhalten lassen. Offensichtlich ist hier die Angst vor Ermittlungen durch den Haager Gerichtshof gering. Herbert Jäger betont, daß Strafe mit dem Ziel der Abschreckung eine minimale Rolle in der internationalen Diskussion spielt. „Es wäre illusionär und realitätsfern, von der Bestrafung einen Beitrag zur Eindämmung staatlicher und kollektiver Verbrechen zu erwarten“ (Jäger, 340). Eine generalpräventive Wirkung und entsprechendes Normbewußtsein entsteht „weniger durch das Strafrecht per se als durch den sozialen Nahraum“ (ebd.). Internationale Gerichtsverfahren sollten in diesem Sinne also „nicht mit Aufgaben überfrachtet werden, die nicht lösbar sind und die nachher die Kritik leicht machen“ (J. Ph. Reemtsma, Frankfurter Rundschau vom 15. Januar 1996).
Literatur:
R. Goldstone: 50 Jahre nach Nürnberg. Die internationalen Strafgerichtshöfe zum ehemaligen Jugoslawien und zu Ruanda, in: Nürnberger Menschenrechtszentrum 1996, S. 57-67;
G. Hankel/G. Stuby: Strafgerichte gegen Menschheitsverbrechen – Zum Völkerstrafrecht 50 Jahre nach den Nürnberger Prozessen, Hamburg 1995;
M. Hauser: Die Perspektive der Opfer, in: Nürnberger Menschenrechtszentrum 1998, S. 47-53;
R. Huhle: Menschenrechtsverbrechen vor Gericht – zur Aktualität der Nürnberger Prozesse, in: Nürnberger Menschenrechtszentrum 1996, S. 13-46;
H. Jäger: Makroverbrechen als Gegenstand des Völkerrechts, in: Hankel/Stuby, S. 325-354;
R. Kößler/H. Melber: Die Internationale Zivilgesellschaft, Frankfurt 1993;
R. Marx: Menschenrechtsschutz als System der kollektiven Sicherheit?, in: Kritische Justiz (1996) 3;
R. Merkel: Das Recht des Nürnberger Prozesses. Gültiges, Fragwürdiges, Überholtes, in: Nürnberger Menschenrechtszentrum 1996, S. 68-92;
Nürnberger Menschenrechtszentrum (Hg.): Der Staatsmacht Grenzen setzen. Wege zur Internationalen Durchsetzung der Menschenrechte, Nürnberg 1998;
Nürnberger Menschenrechtszentrum (Hg.): Von Nürnberg nach Den Haag. Menschenrechtsverbrechen vor Gericht. Zur Aktualität des Nürnberger Prozesses, Hamburg 1996;
K. J. Partsch: Der Sicherheitsrat als Gerichtsgründer, in: Zeitschrift Vereinte Nationen (1994) 1;
F. Rigaux: Internationale Tribunale nach den Nürnberger Prozessen, in: Hankel/Stuby, S. 142-168;
R. Tetzlaff: Demokratie und Menschenrechte als regulative Ideen zum Überleben in der Weltgesellschaft, in: W. Hein (Hg.): Umbruch in der Weltgesellschaft, Hamburg 1994, S. 279-304;
A. Zumach: Die ad-hoc-Gerichtshöfe von Den Haag zum ehemaligen und Jugoslawien. Bilanz aus externer Sicht, in: Nürnberger Menschenrechtszentrum 1998, S. 17-23.