Die jetzt mit mächtigem medialen Rückenwind wieder auf die Tagesordnung gekommene Forderung nach einer Streichung des Begriffs „Rasse“ aus dem Grundgesetz ist gut begründet. Denn Menschenrassen gibt es nicht. Darüber und wieso der Begriff dennoch in alle einschlägigen Menschenrechtserklärungen und –verträge gelangt ist, ging es im vorigen Blogartikel. Am Ende stand dort ein selbstkritisches Zitat von Naturwissenschaftlern und Anthropologen aus einer von der UNESCO geförderten Erklärung (1952), wonach es besser wäre „wenn man von menschlichen Rassen spricht, den Begriff ‚Rasse‘ ganz fallen zu lassen und stattdessen von ‚ethnischen Gruppen‘ zu sprechen.“ Der Satz bringt die Schwierigkeit auf den Punkt, über etwas zu reden, an dessen Existenz man eigentlich glaubt, wofür man aber keinen Begriff mehr hat.
Der Satz bringt, wohl zum ersten Mal, als Ersatz für „Rasse“ den Begriff „ethnische Gruppe“ ins Spiel, den in der heutigen Diskussion auch Viele vorschlagen, so z.B. der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby, der selbst schon Opfer rassistischer Angriffe und Anfeindungen war. Er schlägt vor, statt „Rasse“ „ethnische Herkunft“ ins Grundgesetz zu schreiben. Was aber ist eine „ethnische Gruppe“? Die UNESCO-Erklärung legt ja schon nahe, dass es sich nur um ein anderes Wort für die gleiche Sache handelt, das nur netter klingt. Eine auch nur halbwegs konsensfähige Definition für „ethnische Gruppe“ oder „Ethnie“ gibt es nicht, und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war der Begriff außerhalb „ethno“logischer Fachkreise unbekannt. In den USA hatte er eine Konjunktur im Kontext der großen Einwanderungsbewegungen, vor allem aus Lateinamerika und der Karibik, die das überkommene „Rasse“-Schema von Schwarz und Weiß aushebelten. „Ethnic“ war jetzt alles, was eben weder schwarz noch weiß war, wie es sich ja bis heute in Begriffen wie „ethnic food“ oder „ethnic clothing“ spiegelt, die sich auf alles beziehen – außer auf „Weißes“. Dass „Ethnie“ jedenfalls im deutschen Sprachbereich ein praktischer Ersatzbegriff für das verpönte „Rasse“ ist, hat jedenfalls die AfD begriffen. In ihrem Diskurs kommt „Rasse“ nicht mehr vor, dafür rückt die „Ethnie“ in den Fokus rassistisch geprägter Ablehnung:
Dass die Geburtenrate unter Migranten mit mehr als 1,8 Kindern deutlich höher liegt als unter deutschstämmigen Frauen, verstärkt den ethnisch-kulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur. (Aus Kapitel 6.2. des Parteiprogramms von 2019)
Die Analyse, mit der der Bundesverfassungsschutzes seinen Verdacht auf verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD begründet, konzentriert sich ganz wesentlich auf den Stellenwert eines „ethnisch-homogenen Volksbegriffs“, der Menschen, die dieser „ethnisch geschlossenen Gemeinschaft“ nicht angehören, diskriminiert.
Offensichtlich gewinnen wir also mit dem Begriff der Ethnie als Ersatz für Rasse nicht viel. Schon gar nicht, wenn wir ihn mit „Herkunft“ verbinden. Denn rassistische Diskriminierung interessiert sich nicht notwendigerweise für die Herkunft der Diskriminierten. Die Aufforderung „Geh zurück von wo du herkommst“, richtet sich ja im Zweifelsfall gegen jede(n), der/die als nicht der eigenen Gruppe zugehörig definiert wird, egal woher er/sie kommt. Diskriminierung wegen „ethnischer Herkunft“ würde also viele von Rassismus Betroffene gar nicht erfassen.

Auch eine Reihe weiterer Vorschläge führen zu einer Engführung von Rassismus und mindern den intendierten Schutz vor Diskriminierung. Das gilt z.B. für den Vorschlag, „Rasse“ durch „Hautfarbe“ zu ersetzen, ein Vorschlag, der zum Beispiel Antisemitismus nicht erfassen würde, der dann wohl als eigenes weiteres Merkmal eingeführt werden müsste, aber auch Anti-Ziganismus und so fort. Es sind eben nicht nur „People of Color“, die von rassistischer Diskriminierung betroffen werden. „Hautfarbe“ als Ersatzterminus im Grundgesetz griffe also entschieden zu kurz. Auch die Addierung solcher Begriffe, wie z.B. in der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker (1981), wo die Menschenrechte für Alle „ohne Unterschied der Rasse, ethnischen Gruppe, Hautfarbe …“ garantiert werden (Art. 2), löst das Problem nicht.
Den umgekehrten Weg gehen Vorschläge, die die Perspektive umkehren und statt den Gegenstand, wegen dem nicht diskriminiert werden darf, die Diskriminierungstat als solche ins Grundgesetz schreiben wollen, also statt „Rasse“ „rassistische Diskriminierung“. Der bekannte Publizist Heribert Prantl etwa schlägt die Formel vor „Niemand darf aus rassistischen Beweggründen benachteiligt werden.“ Das klingt gut, die Frage ist nur, ob ein solcher Satz, der ja die Motive der Täter mit ins Spiel bringt, so einfach aus der Sphäre des Strafrechts, wo er sinnvoll und nötig ist, in einen Verfassungstext transportiert werden kann. Denn bei den übrigen Merkmalen, nach denen niemand diskriminiert werden darf, geht es ja nicht um das Motiv für eine Diskriminierung, sondern schlicht um deren Ausschluss. Also nicht z.B. um Schutz vor religiösem Fanatismus, sondern um Schutz für den eigenen Glauben.
In der ausführlichen Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte von 2010 schlägt der Autor Hendrik Cremer daher vor, nicht von rassistischen Beweggründen zu sprechen, also von den Motiven, sondern von einer „rassistischen Benachteiligung“. Dieser Ausdruck würde das subjektive Element, das im Wort „Diskriminierung“ enthalten ist, außen vor lassen, der freilich mit dem Adjektiv „rassistisch“ doch wieder hereinkommt. Vor allem aber, das sieht auch Cremer in seiner Analyse, setzt „rassistische Benachteiligung“ letztlich wieder eine Vorstellung von „Rasse“ voraus, auf die sich der Rassismus bezieht, auch wenn klar ist, dass es menschliche Rassen nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gibt. Im Übrigen sprengt auch diese Formel die Stringenz des Benachteiligungsverbots, indem sie in die Reihe der zu schützenden Merkmale eine Täterperspektive einführt. Die Schönheit der Sprache der Menschenrechte liegt aber gerade in ihrer konsequenten Bezogenheit auf den Schutz der unterschiedlichen Merkmale, die uns Menschen in aller Verschiedenheit ausmachen.
Die einfachste Lösung, zu der sich aber in der deutschen Diskussion kaum jemand entschließen mag, wäre, das Wort „Rasse“ einfach aus dem Katalog der Merkmale zu streichen. Der naheliegende Einwand ist natürlich, dass erst durch den Begriff „Rasse“ Rassismus, also Diskriminierung aufgrund der Rasse, „benennbar und adressierbar“ wird, wie Cengiz Barskanmaz vom Max-Planck-Institut für Sozialanthropologie in Halle und Nahed Samour von Institut für interdisziplinäre Rechtsforschung an der Humboldt-Universität argumentieren. Trotzdem lässt sich fragen, was eigentlich fehlt, wenn „Rasse“ fehlt. Rassistische Diskriminierung kann sich ja auf sehr viel beziehen: äußere körperliche Merkmale, Herkunft, als „abweichend“ wahrgenommenes Verhalten (einschließlich religiöser Praktiken, Essgewohnheiten etc.), sozialer Status, Sprache… Der Phantasie rassistischer Vorurteile, die sich in der Regel aus tiefsitzenden Ressentiments speisen, sind leider kaum Grenzen gesetzt, was die Bekämpfung von Rassismus ja so schwierig macht. Immerhin sind in dem Katalog des Art. 3(3) GG einige Merkmale aufgeführt, die zum Kernrepertoire rassistischer Diskriminierung gehören, nämlich Abstammung, Sprache, Herkunft und Glaube. Die Lücke, die mit der Streichung von „Rasse“ entstünde, betrifft daher vor allem alle körperlichen Merkmale.
Insofern wäre es eine Überlegung wert, statt von „Rasse“ zu sprechen, vor der Benachteiligung „aufgrund körperlicher Merkmale“ zu schützen. Das würde der Logik der Aufzählung von Merkmalen entsprechen und zusammen mit den genannten anderen Merkmalen den größten Teil der Anknüpfungspunkte rassistischer Diskriminierung erfassen. Der Vorschlag würde sogar noch einige andere benachteiligte Gruppen einschließen, die bisher vom Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes nicht berücksichtigt sind, z.B. Kleinwüchsige oder Schwergewichtige, die sich in letzter Zeit verstärkt gegen Diskriminierung wehren. Auch das Merkmal „Kultur“ als neuestes modisches Objekt rassistischer Diskriminierung könnte ergänzt werden.

In diesem Zusammenhang wäre zu fragen, ob nicht überhaupt bei einer Änderung von Art. 3 des Grundgesetzes, für die ja die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit durchaus möglich scheint, der Katalog der vor Benachteiligung zu schützenden Merkmale überprüft werden sollte. Im Vergleich mit internationalen Menschenrechtskatalogen fehlen nämlich durchaus einige Merkmale, die auch häufig Gegenstand von Diskriminierung sind, u.a. sexuelle Orientierung, Alter, und nicht zuletzt sozialer Status. Und vor allem sollte eine Öffnungsklausel angefügt werden, wie sie in der Gestalt der Formel „oder sonstigem Status“ in fast allen internationalen Menschenrechtsabkommen den Katalog der vor Diskriminierung zu schützenden Merkmale abschließt. Aus der unvollständigen und mit dem problematischen Rassebegriff belasteten Aufzählung des Grundgesetzes würde so ein umfassender Diskriminierungsschutz, der auch rassistische Diskriminierung unzweideutig ächtet.
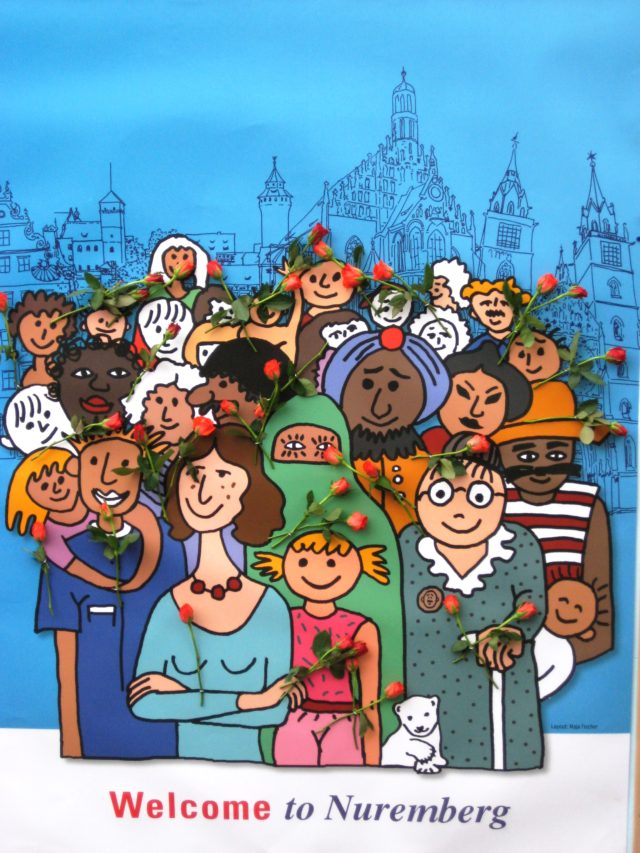
Das der Begriff „Rasse“ unwissenschaftlich ist, d.h. das es eigentlich keine Rassen gibt, bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass es keine Rassisten gibt. Der Rassismus ist ja eben eine Ideologie, die an die Existenz von Rassen glaubt und die Überlegenheit einer Rasse den anderen gegenüber postuliert. Mein Vorschlag: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner sexuellen Orientierung, seiner Abstammung, seiner Hautfarbe, seiner ethnischen oder körperlichen Merkmale , seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Das schließt alles mit ein, oder?
Warum lassen wir nicht einfach die angeblichen Diskriminierungsgründe weg?
Niemand darf diskriminiert, benachteiligt oder bevorzugt werden. Egal aus welchem Grund.