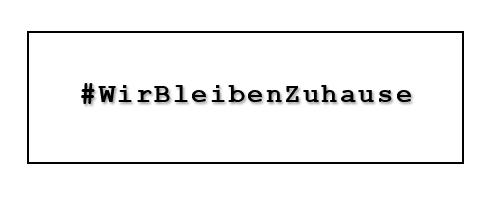Unsere Facebook-Timelines der letzten Wochen sind voll davon: Sonnenuntergänge hinter dem Balkon, gemütliche Fernsehabende mit Pizza und Streaming-Dienst, Kinder im heimischen Garten – erlaubt ist, was alleine stattfindet. Wir sind im Zuge der Coronavirus-Pandemie aufgerufen, zu Hause bzw. nur unter Menschen desselben Haushalts zu bleiben, soziale Kontakte und öffentliche Orte zu meiden. Das klingt gut und logisch, auch wenn man einschränkende Maßnahmen natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten muss.
#CoronaBoredom?
Viele von uns kämpfen mit dem neuen Alltag, in dem vielleicht mehrere Kleinkinder plötzlich dauerhaft zu Hause betreut werden müssen, oder die Pflegekraft für ältere Angehörige fehlt. Oder auch aufgrund von drohendem Kurzarbeitsgehalt oder sogar Jobverlust. Anderen ist – wie man ebenfalls den sozialen Netzwerken zu Genüge entnehmen kann – schon todlangweilig, weil kein Fitnessstudio zur Verfügung steht oder die Grillparty ausfallen muss (#CoronaBoredom).

Und wo wir schon bei Hashtags sind: Quasi als Zeichen gesellschaftlicher Solidarität quellen Twitter und Co. über mit #WirBleibenZuHause, #SocialDistancing und Co. Die Nutzer:innen signalisieren damit, die Pandemie ernst zu nehmen und sich – sofern möglich – von ihren Mitmenschen fernzuhalten. Das bringt Entbehrungen mit sich. Gerade viele ältere Menschen leiden in dieser Situation unter verstärkter Einsamkeit und der notwendigen Abschottung von der eigenen Familie. Auch Menschen mit Depressionen oder anderen Erkrankungen haben auf besondere Weise mit dem Krisenmodus zu kämpfen. Und wer hätte die schönen Frühlingstage nicht einfach gerne mit Freund:innen im Wanderurlaub verbracht oder an jedem warmen Tag mit den Kindern die Eisdiele aufgesucht?
Gleichzeitig müssen wir jedoch feststellen: sich überhaupt „sozial distanzieren“ zu können, ist ein Privileg, das sehr vielen Menschen – in Deutschland und weltweit – nicht zuteilwird. Ihnen stehen weder die räumlichen Möglichkeiten noch die finanziellen Mittel zur Verfügung, sich zu distanzieren.
Welches Zuhause?
Wer zum Beispiel unter prekären Wohnverhältnissen lebt, sich Zimmer, Küchen oder Toiletten mit anderen teilen muss, ist einer wesentlich höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Häufig ist es schlichtweg nicht möglich, zu anderen genügend Abstand zu halten oder Flächen und Gegenstände so oft wie nötig zu desinfizieren. Das betrifft etwa obdachlose Menschen und Geflüchtete in Sammelunterkünften, und Andere, die unter solch beengten Verhältnissen leben. Aber auch Obdachlose, die auf der Straße schlafen und sich zum Selbstschutz oft nicht völlig alleine an einem Ort niederlassen.

Wer aufgrund von finanzieller Not nur wenig Wohnraum zur Verfügung hat, dem fehlt es häufig auch an den nötigen Mitteln, um andere Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir sind aufgerufen, so selten wie möglich einkaufen zu gehen. Doch wie macht man das, wenn man Geld etwa nur im Wochenrhythmus zur Verfügung hat? Oder wenn es in einer kleinen Wohneinheit bei einer Familie mit mehreren Kindern und anderen Angehörigen schlichtweg an Lagermöglichkeiten für Lebensmittel fehlt?
Home Office?
Arbeiter:innen, die sich als Tagelöhner:innen oder mit anderen Gelegenheitsberufen über Wasser halten, können sich beim Wegfall ihrer Arbeit oft auf keine Ersparnisse verlassen. In Deutschland fallen so gerade die Menschen durchs Netz, die ihre Arbeit z.B. aufgrund von Angst vor Abschiebung nicht anmelden konnten. Und auch in vielen anderen Ländern wissen Millionen Menschen nicht, wie sie einen Monat oder gar eine Woche ohne Arbeit über die Runden kommen sollen. Bietet sich dann eine Jobgelegenheit, haben diese Menschen nicht das Privileg, zum Wohle der eigenen Gesundheit abzusagen.
Ebenfalls nicht einfach der Arbeit fernbleiben können unzählige Menschen in sozialen Berufen, in der Pflege, in Krankenhäusern, aber auch in Supermärkten oder Reinigungsunternehmen. Hoffen wir, dass sich Gesellschaft und Politik auch nach Corona daran erinnern, was sie leisten.

Distanz wahren zu können, ist ein Privileg. „Home Office“ mag vielen gerade wie ein Fluch erscheinen und verbunden sein mit Alltagsproblemen und Ängsten; zugleich bleibt der Gedanke daran für unzählige Menschen nichts als ein weitentfernter Traum. Das müssen wir bedenken, wenn wir – national und international – über Maßnahmen und Forderungen sprechen.