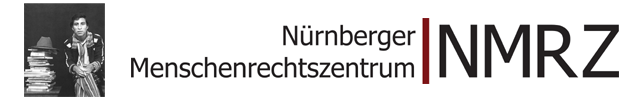Neuere Literatur zur Entwicklung des Kriegs- und Völkerstrafrechts
Gerd Hankel: Die Leipziger Prozesse. Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, Hamburg: Hamburger Edition 2003, 550 pp.
Peter Maguire: Law and War. An American Story, Columbia University Press: New York 2000, 446 pp.
Kai Ambos/Mohamed Othman (eds.): New Approaches in International Criminal Justice: Kosovo, East Timor, Sierra Leone and Cambodia, Freiburg: edition juscrim 2003, 282 Seiten
Die sogenannten “Leipziger Prozesse”, die 1921-1927 auf Verlangen der Siegermächte des 1. Weltkriegs deutsche Kriegsverbrechen aufarbeiten sollten, haben keinen guten Ruf in der Rechtsgeschichte. Großenteils berechtigt werden sie als beschämende Pflichtübung einer Justiz gewertet, die das ungesunde Volksempfinden teilte, dass im Krieg letztlich alles erlaubt sei und dass die von den Alliierten verlangten Prozesse gegen deutsche Militärs wegen vor allem in Belgien begangener Kriegsverbrechen einen Angriff auf die Ehre deutscher Soldaten darstellten. Aus den Hunderten ursprünglich angeklagter Fälle kamen letztlich nur 17 Verfahren zustande, in denen sieben Schuldsprüche mit relativ geringen Freiheitsstrafen ausgesprochen wurden. Und doch machten diese Prozesse bedeutsame Rechtsgeschichte. Erstmals hatte sich ein Höchstes Gericht – das Leipziger Reichsgericht war der damalige “Bundesgerichtshof” – ausführlich mit den strafrechtlichen Aspekten des Kriegsrechts und damit mit dessen Rechtsnatur überhaupt auseinander zu setzen.
Der Bremer Jurist und Rechtshistoriker Gerd Hankel, hervorgetreten u.a. durch Arbeiten zum Nürnberger Prozess und zur strafrechtlichen Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda, hat nun erstmals diese Leipziger Prozesse nicht nur unter Heranziehung des Aktenmaterials und einer enormen Menge an Sekundärliteratur gründlich ausgewertet, sondern auch ihre Bedeutung innerhalb der Herausbildung kriegsrechtlicher und völkerstrafrechtlicher Normen analysiert. Zahlreiche Exkurse in die Geschichte des Kriegsrechts und des Völkerrechts machen deutlich, dass das Verlangen nach einer Verurteilung der Kriegsverbrechen vor einem Strafgericht, abgesehen von dem Vorwurf der “Siegerjustiz”, durchaus umstritten war und sich auf noch sehr schwankendem rechtlichen Boden bewegte. Selbst wenn das Prinzip der Staatensouveränität bei der Kriegführung nicht mehr uneingeschränkt galt, so war doch der Umgang mit den Taten der jeweiligen Armeen immer noch als Teil dieser Souveränität begriffen. Hankel sieht zwar die Relevanz der Prozesse aus heutiger Sicht, analysiert sie aber streng als Historiker, legt also keine Maßstäbe nach heutiger Rechtsauffassung an. Erst diese strenge Methode erlaubt, die Momente festzumachen, die die Leipziger Verfahren trotz allem für die Entwicklung eines veränderten Rechtsverständnisses von den Konsequenzen von Kriegsverbrechen, von persönlicher auch strafrechtlicher Verantwortlichkeit und von den Grenzen staatlicher Willkür hatten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der ausführliche Exkurs Hankels zu dem gescheiterten Vorhaben vor allem Frankreichs, Kaiser Wilhelm vor Gericht zustellen, wegen “schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge”, wie es in Artikel 227 des Versailler Vertrags vorgesehen war. Die von den Alliierten geforderte Auslieferung – an ein noch gar nicht bestehendes internationales Gericht – scheiterte nicht nur an der Weigerung des Aufenthaltslandes des Kaisers, der Niederlande, sondern auch an der Uneinigkeit der Alliierten, die die rechtliche Unsicherheit in dieser Frage spiegelte.
Bemerkenswerter Weise waren es vor allem die USA, die ein Verfahren gegen den Kaiser ablehnten, unter Berufung auf die hergebrachten Regeln des Völkerrechts, die keine persönliche Verantwortung von Staatsoberhäuptern kannten. Bekanntlich waren es nach dem 2. Weltkrieg dann die USA, die in Nürnberg den konträren Rechtsstandpunkt am entschiedensten vertraten und die persönliche Verantwortlichkeit der NS-Verbrecher vor dem IMT durchsetzten – interessanterweise übrigens nicht in Tokyo, wo General McArthur mit Rücksicht auf die Rolle des Tenno in Japan entschied, diesen nicht vor das Kriegsverbrechertribunal zu stellen. Doch für die Weiterentwicklung des internationalen Rechts war entscheidend das Nürnberger IMT. Der dort von Richter Jackson so eindrucksvoll vorgetragene am Prinzip der persönlichen Verantwortung orientierte Haltung der USA hatte viele juristische und politische Gründe und war innerhalb der Alliierten ebenso umstritten wie innerhalb der USA selbst. Das Schwanken zwischen der Forderung nach Bestrafung gemäß internationalen Rechtsstandards und der Reklamierung des Souveränitätsprinzips durchzog allerdings die Geschichte der USA seit langem und ist, wie die jüngste Geschichte zeigt, keineswegs entschieden.
Welche Kräfte mit welchen Überzeugungen, rechtlichen Argumentationen und politischen Zielen dabei in der amerikanischen Geschichte jeweils am Werk waren, darüber informiert nun ein eindrucksvolles Buch des Historikers Peter Maguire, unter dem schlichten Titel “Law and War. An American Story”. Maguire ist der Urenkel eines amerikanischen Richters in Nürnberg, Robert Maguire, der im “Wilhelm-Straßen-Prozess” gegen Ernst v. Weizsaecker u.a. tätig war. Einleitend schildert Peter Maguire auf bewegende Weise, wie ihn die Suche nach der Persönlichkeit seines Urgroßvaters immer weiter in die Suche nach den Rechtsprinzipien hineinzog, die in Nürnberg ihren Höhepunkt erlebten, und wie ihn diese Suche immer stärker auch zur Beschäftigung mit den Widerständen nicht zuletzt in der Geschichte der USA gegen die Anwendung universell gültiger Rechtsmaßstäbe für das Handeln in bewaffneten Auseinandersetzung führte. Das Ergebnis ist eine geradezu spannend zu lesende Geschichte des Kriegsrechts in den USA und im Kontext der amerikanischen Außenpolitik – eine Geschichte des Messens mit zweierlei Maß, wie Maguire schonungslos nachweist, das freilich nicht auf die USA beschränkt ist. Wenn Maguire z.B. ausführlich den brutalen, heute fast vergessenen Vernichtungskrieg der US-Armee gegen die Philippinen um die Wende zum 20. Jahrhundert und die kümmerlichen Verfahren beschreibt, mit denen die amerikanische (Militär-)Justiz einige wenige Verantwortliche an den Massakern zu Disziplinarstrafen verurteilte, dann fällt ihm nicht nur der Vergleich zu den Leipziger Prozessen ein, sondern auch der Standpunkt eines Heinrich Treitschke, dass eben das Völkerrecht (und damit das Kriegsrecht) sich nur auf die Beziehungen zwischen zivilisierten Völkern beziehe, nicht aber gegenüber “barbarischen Völkern” oder “Negerstämmen” gelten könne. Diesen gegenüber sei nur das Statuieren abschreckender Exempel angebracht. Die deutschen Truppen in Südwest, deren Taten in diesem Jahr sich zum hundertsten mal jähren, nahmen es sich ebenso zu Herzen wie die amerikanischen Truppenführern bei der Ausrottung der Indianer.
Da war die Herausbildung einer Doktrin, wonach die Regeln des Kriegsrechts nicht nur generell gültig seien, sondern auch international überwacht und notfalls erzwungen werden sollten, ein großer Fortschritt. Maguire zeichnet ihn und die Beteiligung amerikanischer Juristen und Staatsmänner daran detailliert nach. Die neue Rechtsauffassung blieb allerdings weiterhin umstritten, bis in die Endphase der Vorbereitung des Internationalen Militärtribunals hinein. Diese inneramerikanische Debatte rekonstruiert Maguire sorgfältig, nicht nur weil sie ihn näher an die Ideenwelt seines Urgroßvaters heranführt, sondern weil sie durchaus exemplarisch ist. Interessanterweise war es dabei in den USA das Kriegsministerium, das sich für internationale Standards und einen internationalen Gerichtshof einsetzte, während das zivile Außenministerium wenig davon hielt. Die Gründe für diese Haltung, deren Überwindung im Hinblick auf das IMT wohl ganz wesentlich dem späteren Chefankläger Jackson zu danken war, traten nach dem Ende der Verfahren deutlich zutage. Das State Department setzte von Anfang an darauf, Deutschland als Verbündeten gegen den Kommunismus zu gewinnen und hielt die Prozesse für kontraproduktiv. Ausführlich schildert Maguire im letzten Teil des Buches die Geschichte des opportunistischen rollbacks der Nürnberger Prozesse durch die amerikanischen Behörden nach 1947. Den Dualismus zwischen Prinzipienfestigkeit in der Anwendung internationalen Rechts und opportunistischer “Realpolitik” sieht er als Konstante der amerikanischen Politik. Sein Fazit ist skeptisch: Es sei Zeit, sich einzugestehen, dass das Erbe von Nürnberg wohl doch die Ausnahme und nicht das Setzen neuer Normen gewesen sei. “Im Jahr 2000 sind Menschenrechte und Kriegsverbrechen nur dann ein Problem für die US-Außenpolitik, wenn sie im Rahmen ihrer umfassenden politischen Zielsetzungen verwertbar sind, oder ganz einfach wenn sie zu einem public-relations-Problem werden.” Geschrieben im Jahr 2000, vor dem 11. September und vor dem Irakkrieg.
Gleichwohl geht die Suche nach neuen Formen internationaler Rechtsprechung auf dem Gebiet des Kriegsrechts und der Menschenrechte weiter. “New Approaches in International Criminal Justice” ist ein weiterer Band aus der Publikationsreihe des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Er gibt in übersichtlicher Form Auskunft über eine Form internationaler Strafgerichtsbarkeit, die sich neben den viel beachteten internationalen Strafgerichtshöfen zum ehemaligen Jugoslawien und zu Ruanda sowie dem endlich gegründeten Internationalen Strafgerichtshof (IstGh) in Den Haag relativ unbeachtet von der Weltöffentlichkeit entwickelt hat: den Strafgerichtshöfen, die in einigen Ländern mit bewaffneten Konflikten und schweren Regierungsverbrechen der Vergangenheit mit internationaler Beteiligung, aber als gemischt nationale und internationale Gerichte entstanden sind. Dabei können zwei Modalitäten unterschieden werden. Im Fall von Kosovo und von Osttimor gehen die Gerichtshöfe auf die jeweilige UN-Übergangsverwaltung nach dem Ende des bewaffneten Konflikts zurück. Dabei stand im Fall von Osttimor auch die erneute Erfahrung des Scheiterns des “Modells Leipzig” im Hintergrund, als sich herausstellte, dass die versprochenen Verfahren vor indonesischen Gerichten ähnlich ins Leere liefen wie seinerzeit die Prozesse vor dem Reichsgericht in Deutschland. In Sierra Leone hingegen und in Kambodscha kamen gemischte Gerichtshöfe, nach mehr oder weniger schwierigen Verhandlungen, durch Abkommen zwischen der UNO und dem jeweiligen Staat zustande.
Alle vier Fälle werden von internationalen Fachleuten vorgestellt, wobei immer ein einleitender Beitrag der Darstellung der Hintergründe des jeweiligen Konflikts und der allgemeinen Situation im Land gewidmet ist. Ein zweiter bzw. dritter Beitrag schildert dann die Entstehung, das Mandat, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Arbeit der Gerichtshöfe, die Kontroversen um ihre Mandate und Ausstattung eingeschlossen.
Es zeigt sich, dass die einzelnen Gerichtshöfe sich beträchtlich unterscheiden und ihre Funktionsfähigkeit sehr unterschiedlich beurteilt wird. Während die Gerichtshöfe in Kambodscha und Osttimor wenig vorzuweisen haben und stark unter dem Druck von nationalen Interessensgruppen stehen, scheint etwa das Gericht in Sierra Leone auf gutem Weg zu sein. Ob die gemischten Gerichtshöfe ein zukunftsträchtiges Modell neben dem IstGh sein werden, ist daher noch nicht entschieden. Ohne klaren Willen der nationalen Entscheidungsträger scheinen sie jedenfalls kaum zu funktionieren. Andererseits können solche Gerichtshöfe wesentlich rascher und effektiver arbeiten als ein internationales Gericht, und zudem können von ihnen, wie schon die bisherige Erfahrung zeigt, wichtige Impulse für den Aufbau einer kompetenten nationalen Justiz ausgehen.
Im umfangreichen Anhang des Bandes sind wesentliche Dokumente zu den einzelnen Gerichtshöfen wiedergegeben, insbesondere die entsprechenden UN-Resolutionen und -stellungnahmen sowie die gesetzlichen Grundlagen in den beiden Staaten mit vertraglicher Einsetzung des Gerichts. Damit liegt in handlicher Form eine umfassende Informationsquelle über diese wichtige neue Tendenz internationaler Menschenrechtsgerichtsbarkeit vor.
von Rainer Huhle