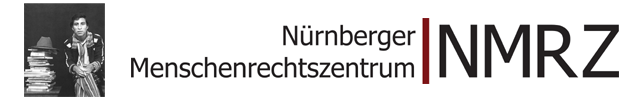Franke & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2008, 156 Seiten
Geht man nach der Lektüre des Buches, so sind die Menschenrechte innerhalb der Aufgaben der UNESCO kurz zusammengefasst, ein „(…) im Geiste der internationalen Zusammenarbeit, der gegenseitigen Verständigung und des Dialogs mit den Regierungsvertretern(…)“ (S. 56) zu opferndes Gut. Harmonie ist den Teilnehmerstaaten wichtiger als die Einhaltung und Umsetzung von Menschenrechten. Eine wirklich offene Auseinandersetzung über die Förderung der Menschenrechte als Kernaufgabe der UNESCO in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur führt die Organisation nicht. Die Organisation hat den Anschluss verloren, mit modernen Verfahren die Einhaltung von Menschenrechten unter ihren Mitgliedstaaten zu überprüfen und einzufordern. Die kritische wie auch ernüchternde Analyse von Hüfner, einem Kenner und Förderer der UNESCO, regt zu der Frage an, wohin die VN-Unterorganisation gegenwärtig strebt und ob sie den weltpolitischen Herausforderungen am Anfang des 21. Jahrhunderts mit ihren Methoden und Arbeitsweisen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt noch gerecht wird? Die UNESCO ist eine der ältesten Unterorganisationen der Vereinten Nationen. Sie hat bereits in ihrem Gründungsstatut von 1945 hervorgehoben, die Zusammenarbeit aller Völker auf dem Gebiet der Bildung, der Wissenschaft und der Kultur zu fördern, mit dem Ziel damit den Frieden, die Demokratie und die Menschenrechte in ihren Mitgliedstaaten zu festigen. Diese Vereinbarung haben ihre Mitglieder getroffen, noch Jahre bevor die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 verabschiedet worden ist und lange bevor der ECOSOC der Vereinten Nationen, die Menschenrechtskommission und die Generalversammlung die Menschenrechtesausschüsse zur Überprüfung der Menschenrechtspakte und -konventionen ins Leben gerufen haben.
Genau darin liegt das Dilemma: 1945 war die UNESCO innovativ und ihrer Zeit voraus, aber seither haben sie ihre Mechanismen und Verfahren der Realität und den Anforderungen der sich veränderten Menschenrechtslandschaft nicht angepasst. Und das obgleich sie als erste VN-Organisation 1952 ein Individualbeschwerdeverfahren für alle Mitgliedstaaten zwingend eingeführt hat (S. 46ff). In wenigen Fällen wurden diesen Beschwerden z.B. über eingeschränkte Freiheitsrechte von Lehrern oder Wissenschaftlern oder gar deren Inhaftierungen, vom Exekutivrat der UNESCO stattgegeben. Der Rat forderte die betreffenden Mitgliedsstaaten auf, die Inhaftierten zu begnadigen. Dieses Verfahren hätte auch in anderen VN-Organisationen oder bei der Menschenrechtskommission verbindlich für alle Staaten eingeführt werden können, wenn der politische Wille dies gewollt hätte.
Doch die UNESCO agierte nicht als Vorreiter innerhalb des VN-Systems. Hüfner beschreibt überzeugend, wie die Überprüfungsverfahren der UNESCO denen der Vereinten Nationen nicht angepasst wurden und warum sie daher heute in ihrer Wirksamkeit eingebüsst haben. Dies ist auch Ursache dafür, dass heute einige Staaten das Beschwerdeverfahren ganz abschaffen wollen. Einzelne Mitglieder des Exekutivrates sind sogar der Ansicht, dass Menschenrechtsthemen überhaupt eher Angelegenheit der VN-Ausschüsse sind und nicht die der UNESCO; und dies obgleich die VN-Ausschüsse nur das Instrument des „freiwilligen“, also fakultativen, Individualbeschwerdeverfahrens kennen. So bleibt von der gegenwärtig stattfindenden Verfahrensdiskussion vor allem eines übrig, nämlich dass die UNESCO sich auf ihre Kernarbeit, d.h. auf die Überprüfung der 193 freiwilligen Staatenberichte, die nur unregelmäßig oder gar nicht eintreffen, beschränken soll. Über Empfehlungen und nette Fragen an die Vertreter der Mitgliedstaaten im bildungs- und wissenschaftlichen Bereich oder der kulturellen Förderung, gehen die Äußerungen der Mitglieder in den UNESCO-Ausschüsse nicht hinaus. Hinzu kommt die eher sporadische Zusammenarbeit mit anderen Sonder- oder Unterorganisationen sowie anderen Organen der Vereinten Nationen, z.B. ILO im Bereich der Lehrerausbildung, oder dem VN-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf sowie den einzelnen VN-Menschenrechtsausschüssen. Hierbei geht es aber in erster Linie um Informationsaustausch und in wenigen Fällen um gemeinsame Erklärungen (S. 29ff). Die Menschenrechtsbildung indes war seit Anbeginn ein Steckenpferd der UNESCO und in diesem Bereich kann sie einige Erfolge und Fortschritte aufweisen. Sie setzte bereits in den 1950er Jahren mit Erklärungen zu dem Thema Menschenrechte in der Schule und außerschulischen Bildung Standards und förderte im Rahmen von Fachtagungen den internationalen Austausch. Die Organisation war maßgeblich daran beteiligt, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1994 die VN-Dekade für Menschenrechtsbildung (1995-2004) ausrief. Zuvor hatte sie Staatenvertreter und NGOs vernetzt, die sowohl auf der UNESCO Tagung in Montreal als auch auf der Wiener VN-Weltmenschenrechtskonferenz 1993 einen Aktionsplan und die Dekade einforderten.
Dementsprechend finden sich in dem Buch detaillierte Auflistungen aller Erklärungen, Verabschiedungen und Konferenzen zu den bildungspolitischen Fragen sowie Organigramme der Organisation zum Verfahren und den Beschlüssen wieder. Ebenso ernüchternd wie empfehlenswert ist das Buch, da es einmal mehr aufzeigt, wie schwer sich eine internationale Organisation damit tut, notwendige Verfahrensreformen einzuleiten. In einer sich globalisierenden und virtualisierenden Bildungs-, Forschungs- und Kulturlandschaft wäre die UNESCO mehr den je ein wichtiger Akteur, um dringend notwendige, zeitgemäße internationale Standards zu schaffen und die dafür nötigen politischen Weichenstellungen einzuleiten. Denn den Menschenrechtsverletzungen im Sinne des steigenden Missbrauchs von intellektuellem Eigentum, dem Datenklau, der Manipulation oder Propaganda kann nur global und in Abstimmung mit allen Staaten Einhalt geboten werden. Zu dieser grundeigenen Aufgabe der UNESCO schreibt Hüfner leider nichts. Wohl auch, da sich diese Themen gegenwärtig nicht auf der Prioritätenliste der politischen Agenda der Organisation finden. Nicht zuletzt auch, da die Harmoniebedürftigkeit (S. 62) der Staatenvertreter in der Organisation derart stark verankert ist, dass schwierige Themen ernsthaft und auf lange Sicht nicht angegangen werden.
von Anja Mihr