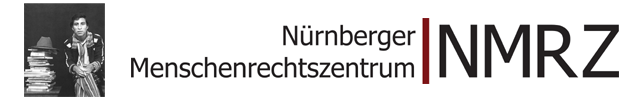von Dieter Maier
Neuzeitliche Folterkollektive stellen irreale Szenerien auf. Sie verzerren Raum, Zeit und Sprache. In Schilderungen von Folterorten und –arten taucht immer wieder Bizarres auf, Nachstellungen archaischer Bilder, Decknamen und groteske Gespräche, gespaltene Persönlichkeiten, Verzerrungen von Ort und Zeit. Einige Beispiele:
Die Folterer der griechischen Obristendiktatur wurden so ausgebildet, dass die moralischen Werte der griechischen Gesellschaft nicht mehr galten. An Stelle dieser Gesellschaft trat das Kollektiv der Folterer mit seinem eigenen Kodex. Die Rekruten mussten stundenlang den „Babygang“ üben: Ein Ausbildungsoffizier nahm sie wie ein Kind bei der Hand und ließ sie hüpfen wie ein Affe, während sich die anderen Rekruten darüber amüsierten (Haritos-Fatouros 1991, S. 89). Hier wurde im Wortsinn Ent-Menschlichung eingeübt, und der Rekrut wurde auf eine frühkindliche Stufe der Persönlichkeitsentwicklung zurückgeworfen, in der sich das Gewissen noch nicht ausgebildet hat. Dann wuchs er als vormoralische Wesen in das Folterkollektiv hinein.
Westliche Diktaturen nach dem zweiten Weltkrieg folterten im Untergrund, denn nach Hitler und Stalin war die aufklärerische Ächtung der Folter ein weiteres bekräftigt worden. Die Folterorte, Folterer, Folterarten und Opfer hatten Decknamen oder (bei den Opfern) Nummern. Normale Gespräche zwischen Tätern und Opfern waren nicht üblich oder verboten (z.B. in Haritos-Fatouros 1991, S. 81, 85). Das Wort „Folter“ war und ist tabu.
„Guantánamo“, als US-Stützpunkt in Cuba bereits ein unwahrscheinlicher Ort, ist zum Begriff entorteter Folter geworden. Er steht für ein Netz von namenlosen geheimen Haftorten des „Antiterrorkriegs“, das scheinbar an kein Territorium gebunden ist. Die Folter erfindet sich ihren Schauplatz. Folterer rechtfertigen sich damit, dass der Staat Krieg gegen einen unsichtbaren inneren Feind führen müsse. Der erste Adressat dieser Kriegshypothese ist das Kollektiv der Folterer. Sie legitimiert die Folter gegenüber den Tätern selbst. Sie schafft einen imaginierten Kampfplatz, der es den Folterern erlaubt, sich als Kombattanten zu verstehen. Die Waffe der Folterer war im Selbstverständnis Osvaldo Romos, des bekanntesten Folterers der Pinochet-Diktatur, das Elektroschockgerät, die der Gefolterten ihr unterstellter Fanatismus. Romo stellt in einer Serie von Interviews, die er als Häftling gab, die Opfer 1995 (also 15 Jahre nach Ende der Diktatur) immer noch als „bis an die Zähne bewaffnet“ (Guzmán 2000, S. 140) und zum Mord an den Streitkräften entschlossen dar; er unterscheidet seine Opfer in die Tapferen, die der Folter standhielten, und die Feiglinge, die schon „gesungen“ haben, ehe noch jemand Hand an sie gelegt habe (Guzmán 2000, S. 100, 110 ff u.a.). Diese Fiktion von Waffengleichheit und militärischer Tugend soll im Nachherein rechtfertigen, was den Normen moderner Gesellschaften diametral entgegensteht: die Quälerei wehrloser Menschen. Die Folter muss einen über den aktuellen Zweck der Abpressung von Informationen hinausweisenden Sinn haben, damit der Folterer sie durchhält. Die Kriegshypothese stellt diesen Sinn bereit.
Romos Chef im Geheimdienst DINA war Miguel Krassnoff. Krassnoff ist wie Romo zu mehreren Haftstrafen verurteilt und sitzt sie in einem Gefängnis in Santiago ab. Dort hat er einer befreundeten Autorin Interviews für ein Buch gegeben, in dem er sich rechtfertigt. Die Mutter eines seiner Opfer hat mit einem weiteren Buch darauf geantwortet. Das Buch über Romo und die beiden Bücher zu Krassnoff zeigen, wie Folter irrealer Bedingungen bedarf und die Folterer sie schaffen, wenn sie sie nicht vorfinden. Krassnoff ist Spross einer Kosakenfamilie, die über zwei Generationen gegen den Kommunismus kämpfte Er setzte diesen Kampf in Chile als Agent der DINA fort, um seine von den Kommunisten zerstörte Familie zu rächen. Er hat auf dem falschen Kontinent gegen die falschen Feinde gekämpft und sitzt nun im falschen Jahrhundert und Gefängnis seine verdiente Strafe ab. Er ließ seine Familie in dem Glauben, er arbeite im Verteidigungsministerium, wenn er zum als Privathaus getarnten Folterzentrum fuhr. Folter und Alltag bedürfen in aufgeklärten Zeiten getrennter Szenen.
Die Folterer verschieben nicht nur den Ort ihrer Taten ins Irreale, sondern auch die Zeit. Immer wieder gibt es Berichte über Stigmatisierungen, die an das mit der Folter assoziierte Mittelalter erinnern, so etwa, wenn Gefangenen Wunden beigebracht werden, die kreuzförmige Narben bilden (z.B. in Haritos-Fatouros 1991, S. 85). Das Kreuz steht ikonographisch für die Folter (die Auspeitschung vor dem Kreuzgang, Nägel, Dornenkrone).
In Chile gab es eine aufschlussreiche Inszenierung des Irrealen nach einer identifizierbaren, archaischen Vorlage, bei der ein spontan entstandenes Folterkollektiv agierte . Im Oktober 1973, zwei Monate nach dem Putsch der Militärs, die das Land schon fest im Griff hatten, trafen sich in der abgelegenen Region Mulchén im Süden des Landes einige Carabineros (Militärpolizei) und Großgrundbesitzer und stellten eine Liste von zu verhaftenden Personen zusammen. In Mulchén tat niemand gerne Dienst. Die Gegend ist kalt und unwegsam. Die Carabineros unter dem Kommando von Leutnant Jorge Maturana Concha, dessen militärische Karriere wegen schlechter Noten schleppend verlaufen war, zogen erst mit Lastwagen und dann mit Pferden los und verhafteten gruppenweise junge Landarbeiter, die sie an einer Uferböschung erschossen oder ihr eigenes Grab graben ließen, sie zwangen, sich mit dem Gesicht nach unten hineinzulegen und dann erschossen. Niemand leistet Widerstand.
Eine der Gruppen bestand aus insgesamt 12 Brüdern von drei Familien. Sie mussten eine bitterkalte Nacht mit Draht und Seilen gefesselt in einem offenen Verschlag verbringen. Die hungrigen und frierenden Gefangenen stöhnten wegen der erlittenen Schläge und Tritte, beteten und legten sich übereinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Nach einem Gelage gingen die Carabineros und ein Gutsverwalter um zwei Uhr früh durch Schneeregen zu dem Verschlag und inszenierten einen antike Gladiatorenkampf: Die Gefangenen mussten sich gegenseitig mit Keulen niederschlagen. Die Verlierer sollten am nächsten Tag hingerichtet werden (was auch geschah), die Sieger die Freiheit erhalten. Nach einer Stunde lagen Alle außer Dreien blutend, weinend oder ohnmächtig am Boden. Einen der Sieger, José Guillermo González Albornoz, fesselten die Carabineros an einen Traktor, wo sie ihn vergaßen und erst nach drei Tagen losbanden und erschossen, so der Zeitungsbericht. Die beiden anderen, die Brüder Germán und José Nieves, ließen sie frei. So ernsthaft war die Inszenierung trotz allen Gelächters der Zuschauer.
In einem der wenigen Kinos der Gegend war irgendwann davor Stanley Kubricks Film Spartacus gelaufen. Spartacus war der Anführer eines Sklavenaufstands im römischen Reich, der vom Militär besiegt worden war. Tausende der Sklaven wurden in der damals üblichen Weise hingerichtet: Sie wurden gekreuzigt. Spartacus musste ein Gladiatorenduell mit seinem besten Freund bestehen. Der Sieger sollte am Leben bleiben. Diese Szene war offenbar die Vorlage für die Folterinszenierung.
Der chilenische Autor León Gómez Araneda, ein überlebender politischer Gefangener, schildert in seinem noch während der Diktatur erschienenen Buch ¡Que el pueblo juzgue! (Santiago 1988, S. 166ff) die „Marxistenjagd“ von Leutnant Maturana und seinen Männern mit vielen Details und Namen der Täter und Opfer. Offenbar hatte er keine Augenzeugen des Gladiatorenkampfes; die Episode, die er in zwei Zeilen erwähnt, ist dort nicht ganz verständlich. Gomez erwähnt den Befehl zum Bruderkampf und gleich danach die Freilassung der Brüder Nieves. Über Folter und Tod von José Guillermo González überliefert Gómez eine Version, die ihm wohl als Zeugenaussage zugegangen war, tatsächlich aber eine Mythenbildung ist. Sie banden, so der Text bei Gómez, einem der Überlebenden des Kampfes in einer Garage mit Stacheldraht beide Arme in Kreuzigungshaltung fest. Sie sollen eine Dornenkrone aus Stacheldraht gemacht und ihm aufgesetzt haben. Auf seinem Schädel habe die Dornenkrone kleine Wunden hinterlassen, aus denen etwas Blut floss. Auch hier wurde die Ikonografie der Kreuzigung Jesu von Nazareth übernommen.
Die viertägige Aktion der Carabineros forderte 18 Todesopfer. Maturana legte Ende 2007 nach jahrelangem Leugnen ein Geständnis ab. Im April 2008 rekonstruierte ein Richter die Szene vor Ort mit sieben Angeklagten und einigen Zeugen, darunter ein „siegreicher Gladiator“, – sein Bruder war verstorben. Die Polizei musste Handgreiflichkeiten zwischen den Zeugen verhindern.
Die Carabineros und ihre zivilen Auftraggeber hatten offenbar keine Foltererfahrung und keine entsprechenden Instrumente. Sie hatten ihren Hass, der in dieser abgelegenen Gegend archaische Züge trug. Es ging, wie bei Kain und Abel, um Land. Landbesitz verleiht Macht, und die Abhängigkeit vom Gutsherrn einen der Leibeigenschaft vergleichbaren Status. Auch das mag den Rückgriff auf die antike Vorlage erklären.
Die Folter ist der Bruch mit der Normalität westlicher Gesellschaften nach Auschwitz und dem Gulag. Dieser Bruch funktioniert mittels einiger Übergänge wie Symbole, Stigmata und inszenierter Täter- und Opferrollen. Die Täter brauchen Symbole wie den Gladiatorenkampf, um gemeinsam handeln zu können. Die Folterer verwirklichten ein Bild, das sie sich von den Gefangenen und sich selbst gemacht haben. Sie wollen die Opfer nicht als Menschen wahrnehmen. Der Zeitungsbericht und das Buch über das Massaker von Mulchén sprechen von entstellten Gesichtern und dem Mit-dem-Gesicht-nach-unten-Legen vor der Erschießung.
Die Opfer ersetzen die Unerträglichkeit des Erlittenen durch sinnvermittelnde Bilder. Die Erzählung von der Kreuzigung in Mulchén dürfte die von einem der Opfer vorgenommene Ersetzung der real inszenierten antiken Folterpraxis durch eine andere, in einem katholischen Land wie Chile akzeptablere gewesen sein. Das Leiden zur Belustigung der Täter wird zu einem sinnvollen, mit Erlösung konnotierten Leiden umgedeutet. Es mag die Version gewesen sein, die der überlebende Bruder seiner Familie anbot, um nicht wie Kain bis zum Rest seines Lebens in der Fremde leben zu müssen. Sinnloses Leiden ist noch im Nachherein unerträglich. Folteropfer, die für die Partei gelitten hatten und dann erfahren, dass eben diese Partei sie verraten hatte oder sich wegen Bedeutungslosigkeit auflöst, durchleben eine existentielle Krise. Die Deutung als Martyrium soll dem Leiden nachträglich einen Sinn geben. Die fromme Legende zeigt die Schwierigkeiten bei der Bewertung und Interpretation von Folterberichten auf. Die Erinnerungen der Täter und auch der Opfer deuten die Folter als sinnvoll und in die weitere Biografie integrierbar.
Die Menschenrechtsarbeit gegen die Folter müsste es sich zur Aufgabe machen, den Schein, ohne den die Folter nicht auskommt, zu zerstören. Schon eine Sprache, die die Folterinszenierung übernimmt , ist ein unbewusstes Zugeständnis an die Unmenschlichkeit.
Literatur:
Gomez Araneda, León: ¡Que el Pueblo juzgue!, Santiago 1988
Guzmán, Nancy: Romo – Confesiones de un Torturador. Santiago, Planeta 2000
Haritos-Fatouros, Mika: “Die Ausbildung des Folterers – Trainingsprogramme der Obristendiktatur in Griechenland“, in: Jan Phillip Reemtsma: Folter. Zur Analyse eines Herrschaftsmittels, Hamburg, Junius 1991
Silva Encina, Gisela: Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile. Santiago, 1. Aufl. 2007, 2. Aufl. 2008
Yáñez, Mónica Echeverria: Krassnoff – Arrastrado por su destino.
Santiago de Chile, Catatonia 2008