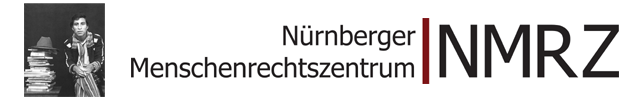Tom Segev: Simon Wiesenthal: die Biografie. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. München, Siedlerverlag 2010.
Guy Walters: Hunting Evil: How the Nazi Criminals Escaped and the Hunt to Bring Them to Justice. Bantam Press, London 2009
Bei der öffentlichen Kritik an jüdischen Repräsentanten ist Sensibilität geboten. Man kritisiert sie als diese Repräsentanten und damit als Juden. Das aber ist ein Einfallstor für Antisemitismus, und sei es für dessen unbewusste Spielart. Aber wen hat Wiesenthal repräsentiert? Unser schlechtes Gewissen? Wiesenthal war der Lückenbüßer für die Unfähigkeit der Österreicher und Deutschen, die Judenvernichtung aufzuarbeiten. Es war entlastend, dass es diesen Juden gab, der die Defizite der deutschen (BRD und DDR) und österreichischen Justiz bei der Strafverfolgung von NS-Verbrechen ausglich. Wiesenthal stand für einen moralischen Anspruch, auf den das ganze Gewicht der Judenvernichtung als Gravitationsfeld einwirkte. Das blockierte bis vor kurzem eine Kritik an ihm. In Deutschland gab es Ansätze dazu (vgl. Artikel “ODESSA: Arbeit am Mythos”), die aber kaum durchdrangen. Hier wäre eine banale Geschichte abgelehnter Rezensionen, ignorierter Kritik und gewundener Klappentexte zu erzählen. Lassen wir´s. Es kam, wie es kommen musste: Die Kritik an Wiesenthal kam aus dem Ausland, und ebenso der Versuch seiner Rehabilitierung.
Der britische Journalist Guy Walters hat in einem Buch ausgeführt, was Kenner der Materie schon wussten: Simon Wiesenthal ist keine saubere Quelle. Er war, so Walters starke Worte, ein Lügner und Angeber, der rücksichtslos und unverantwortlich vorging. Walters Buch ist keine Wiesenthal-Biografie, aber je weiter der Autor recherchierte, desto stärker geriet Wiesenthal in seinen Fokus und ist zum Thema von Hunting Evil geworden.
Walters Abrechnung mit Wiesenthal beginnt bei dessen autobiographischen Schilderungen, in denen vieles nicht stimmt. Das wäre nicht das Schlimmste, denn Dichtung und Wahrheit liegen bei Autobiographien nahe beieinander. An die Autobiografien von Überlebenden der KZs können nicht die üblichen Maßstäbe angelegt werden. Ob sie sich als Juden gefühlt hatten oder nicht: Die NS-Herrschaft machte sie ohne Unterschiede zu Mitgliedern einer „jüdischen Rasse“. Diese Rasse gibt es nicht, aber was machten diejenigen, denen der Judenstern aufgezwungen worden war, nach 1945? Sie mussten sich ihre Identität neu aufbauen. Die zahlreichen autobiografischen Schriften Wiesenthals, auf die Segev hinweist, zeugen davon. Das Überleben wird zu einer lebenslangen Last, auch wenn die Verfolgung aufgehört hat. Wiesenthals Leben und Arbeit ist imprägniert von dieser Mühe des Weiterlebens. Dass Überlebende Schrullen haben, auch die von Walters diagnostizierte Eitelkeit Wiesenthals, muss eine Biografie über ihn im Blick haben.
Walters‘ Kritik zielt unmittelbar auf das Lebenswerk Wiesenthals, die Jagd nach Naziverbrechern. An einigen Stellen hat er fraglos recht. Wiesenthal hat Fakten erfunden und sich Verdienste zugerechnet, die ihm nicht zukamen. Von den zahlreichen Beispielen seien die beiden bekanntesten erwähnt. Die legendäre SS-Fluchthilfeorganisation ODESSA gab es nicht, sie ist ein von Wiesenthal (und der Stasi!) geschaffenes Phantom[1]. Auch die Entdeckung Eichmanns in seinem argentinischen Unterschlupf war nicht Wiesenthals Werk, wie er behauptet. Seine Initiativen zur Auslieferung des nach Chile geflohenen Gaswagen-Organisators Walther Rauff waren öffentlichkeitswirksam und politisch sinnvoll, aber Akten des Auswärtigen Amtes (die Walters nicht kennt) relativieren seine Rolle erheblich (vgl. Artikel “Eine lange Nachgeschichte – Der Fall des SS-Standartenführers Walther Rauff nach 1945 in Chile”). Ein israelischer Diplomat hat es auf eine schlüssige Formel gebracht: Wiesenthal war ein Nazijäger, aber kein Nazifänger.
Der israelische Historiker Segev greift in Simon Wiesenthal: die Biografie, was Wiesenthal und Rauff betrifft, ganz und gar daneben. „Danach (1962-72) war er [Rauff] für einige Zeit verschwunden“. Vielleicht für Wiesenthal, aber nicht für den Rest der Welt. Rauff wurde 1962 in Chile wegen eines deutschen Haftbefehls verhaftet, und es begann ein Auslieferungsverfahren, das der Oberste Gerichtshof in Santiago stoppte. Das ging breit durch die Presse. Rauff lebte unter seinem richtigen Namen in Chile. 1966 fand ihn ein Team des US-Senders NBC-TV und strahlte ein Interview mit ihm aus.
Solche Schnitzer können Segev nur passieren, weil er sich fast ausschließlich auf Wiesenthals Archiv und dessen ausführliche Korrespondenzen stützt. Segevs Kronzeuge zu Wiesenthal ist allzu häufig Wiesenthal, und das führt zu einem Verlust an kritischer Distanz. Segev kritisiert an Wiesenthal in etwa dieselben Punkte wie Walters, wenn auch mit mehr Einfühlung, aber er nimmt Wiesenthal zu sehr beim Wort. Der ständige Bezug auf Wiesenthal als Quelle führt notwendigerweise zu Rückkopplungen, bei denen Wiesenthals Selbststilisierungen ohne kritische Sichtung in „Die Biografie“ (so Segevs Untertitel) eingehen.
Wiesenthal war unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg einer der wenigen, die auf das Versagen der Justiz gegenüber Naziverbrechern hinwiesen und handelten, wenn er sah, dass Judenmörder unbehelligt lebten. Es gab viele Nazijäger damals, die so anonym wie möglich arbeiteten; Wiesenthal exponierte sich, und deshalb kamen Informanten zu ihm. Je besser die diskreten Nazijäger sich tarnten, desto sichtbarer wurde Wiesenthal. Er war die Kehrseite eines unauffälligen oder unsichtbaren Netzwerks, das zu erforschen weit mehr Mühe machen würde als die immerhin gründliche und lange, mit vielen Reisen verbundene Recherche von Walters. Gewiss, Wiesenthal gefiel sich in dieser Rolle, aber für Kritik oder Lob seiner Figur sollte deren Prominenz zweitrangig sein. Wiesenthal durfte sein Netzwerk und seine Konkurrenten nicht nennen, und er musste sich exponieren, um als politische Autorität Druck ausüben zu können.
Der Nestbeschmutzer
Wiesenthal war in Österreich verhasst und galt als Nestbeschmutzer, denn das Land beanspruchte, das erste Opfer Hitlers gewesen zu sein. Während in Deutschland das schlechte Gewissen die antisemitischen Impulse unterdrückte, kamen sie in Österreich recht ungeschminkt zum Vorschein. Segev bringt Beispiele genug. In dieser Umgebung wurde Wiesenthal zur Hassfigur. Unbewusste Schuldgefühle produzierten, wie die Wiener Zeitschrift Profil schreibt, das Bild des jüdischen Racheengels, der dem großen Verbrechen die große Strafe folgen lässt.
Segev nennt Wien „das ideale Betätigungsfeld für Spione aus aller Welt“ (S. 142). Und hier begann der in einem Kronland der K.u.K. geborene Altösterreicher Wiesenthal als eine Art Privatspion. Die Unmöglichkeit, als prominenter Jude in Wien zu leben, wo Hitler zum Antisemiten wurde, wie er in Mein Kampf schreibt, und wo in Laufnähe von Wiesenthals Büro eine Straße nach einem antisemitischen Bürgermeister benannt ist, den Hitler in seinem Buch lobend erwähnt, löste Wiesenthal durch ein bewusst gechaffenes, scharfes Eigenprofil auf. Wien war der Ort, wo jeder, der nicht ins Heimatmilieu hineingeboren ist, um seine Selbstdefinition kämpfen muss. Der hässliche Streit Wiesenthals mit Bruno Kreisky (Jude und Sozialdemokrat), wer denn Jude und wer Österreicher sei, die kleinlichen Machtkämpfe innerhalb der Wiener jüdischen Gemeinde sind auf diesem Nährboden gewachsen. Auch die unerfreuliche Konkurrenz zwischen Beate und Serge Klarsfeld und Wiesenthal wird im Kontext innerjüdischer Fraktionierungen verständlich. Es gehört ohnehin zu den interessantesten Aspekten von Segevs Buch, seine Figuren aus der ungewohnten Perspektive eines israelischen Juden gedeutet zu sehen. Simon Wiesenthal: die Biografie ist ein sehr jüdisches Buch, nicht einmal die Witze fehlen.
Das Spionagemilieu
Wiesenthal hat sein Dokumentationszentrum aus dem Nichts geschaffen. Er war Autodidakt ohne nennenswertes Mitarbeiterteam. Wo es kein Vorbild gibt, entstehen Eigenwilligkeiten, selbst geschaffene Kanonisierungen, ohne die die Arbeit keine Struktur bekäme. Dann nahm seine Jagd nach Nazis Dimensionen an, die er organisatorisch und infrastrukturell nicht bewältigen konnte. „Das hier ist das letzte Büro!“, sagte er einmal, Briefmarken ausschneidend, zu mir, als er vor seinem Schreibtisch, auf Augenhöhe mit seinen Besuchern, auf den Kabelsalat verwies, der über die Regale lief.
Das Milieu, in dem Wiesenthal arbeitete und seine Informanten hatte, war obskur. Es gab Nazis, die ihm Informationen über frühere Freunde steckten, um alte Rechnungen zu begleichen. Wilhelm Höttl etwa, ein hoher österreichischer Funktionär des Reichssicherheitshauptamts, spielte nach dem Krieg die Rolle eines Doppelagenten zwischen Ost und West und lebte zudem von seinen revisionistischen Schriften. An solchen Figuren führte für Wiesenthal kein Weg vorbei. Geldzahlungen gegen Informationen sind heikel, aber in konkreten Situationen eine logische Option. Aber auch die Zeugnisse von KZ-Überlebenden sind gelegentlich von Traumata und Suggestionen getrübt. Wiesenthal mag hier manchmal zu gutgläubig gewesen sein, aber es ging ihm um Einzeltäterschaft, und um die zu beweisen haben sich gut ausgestattete Gerichte schwer getan.
Auch Segev merkt getreulich an, dass Wiesenthal immer wieder die Fantasie durchging. Wenn Wiesenthal einmal sagt, dass er in Auschwitz war, und dann wieder, dass er nicht da war, sind Zweifel an seiner Seriosität geboten. Segev kommt zu Schlussfolgerungen wie der, dass „ Wiesenthal zumindest den eigentlichen Kern der Geschichte nicht erfunden hat“ (S. 129 im Zusammenhang der Eichmann-Entführung, s.a. S. 136). Damit mogelt er sich um das Problem herum. Wiesenthal hat ODESSA erfunden oder ist auf Fehlinformationen reingefallen. Statt die Anfangsversion zu korrigieren, hat er sie ausgeschmückt und einen Mythos geschaffen, an den die Welt bereitwillig geglaubt hat und der erst in den letzten Jahren widerlegt wurde. Die Widerlegung kommt bei Segev nicht vor. Allerdings zitiert er aus dieser Literatur, wenn es seine Lesarten stützt (S. 137, Fußnote 21, es gibt weitere pauschale Quellenhinweise, die eher verdunkeln als erhellen). Statt auf die Diskussion zum Thema einzugehen, munkelt er, die ganze Wahrheit sei noch nicht ans Licht gekommen und zitiert pauschal ein Buch, das immerhin einiges Licht in die Sache bringt. Aber um das zu merken, muss man es gelesen haben. Segev zieht sich lapidar und ohne Begründung auf Unbeweisbarkeit zurück (S. 137). Sein Buch besteht aus diesem schwer fassbaren „Wahrheitskern“ und einer Unzahl von Anekdoten, die sich darum herum ranken.
Auf dem Sockel
Als die zeitliche Distanz zum Hitlerreich groß genug war, hievte man Wiesenthal auf einen Sockel. Nun stocherte er nicht mehr in einer unverheilten Wunde, sondern war Vorkämpfer der Gerechtigkeit. Die Öffentlichkeit war der Motor dieser Erhöhung. Wiesenthal selbst benutzte die Presse wie ein Pianist die Klaviatur. Ich sprach ihn einmal auf eine Information an, die ich nicht glauben konnte, und er antwortete seelenruhig, das habe er gesagt, um den Feind aus der Reserve zu locken. Eine ähnliche Episode erwähnt Segev: Wiesenthal setzte in die Welt, Eichmann lebe in Kairo, und verfolgte dann gutgelaunt die Meldung in der Presse. Er glaubte, er habe damit „der jüdischen Sache propagandistisch gedient“ (S. 144). Er gab, wie ihn Walters zitiert, der Presse das Fressen, das sie wollte. Wenn Wiesenthal auf falscher Spur war oder gar einen Unschuldigen verdächtigte und die Behörden nicht gleich reagierten, vermutete er Komplizenschaft und gab ein Zeitungsinterview. Damit überreizte er ein Mittel, das alle MenschenrechtsarbeiterInnen routinemäßig benutzen, weil sie kaum ein anderes haben. Äußerste Diskretion, um die Nazijagd nicht zu gefährden, und offensive Pressearbeit, um sie voranzutreiben, das verträgt sich auf die Dauer nicht. Die Zwiespältigkeit Wiesenthals geht auf die Rolle zurück, die er übernahm, als es damit nichts zu gewinnen und viel zu verlieren gab. Diese objektiven Bedingungen übersieht Walters.
Man könnte meinen, die List der Vernunft sei am Werk gewesen, als die beiden Bücher gleichzeitig geschrieben wurden wie These und Antithese. Vielleicht ging es nur kontrovers und ein wenig parteiisch. Für emotionsfreie Studien zu diesem Thema ist es noch zu früh. Dass die Bücher nun so vorliegen, ist eine produktive Herausforderung. Biografien von Menschen, die den Holocaust überlebt haben, müssen die völlig verschiedenen Kontexte vor und nach 1945 methodisch reflektieren. Die meisten laden die Jahre der Verfolgung dramatisch auf und flachen für die Zeit danach ab. Die Zeit nach „45“ ist die lange Nachgeschichte. Bei Wiesenthal geht das nicht. Segev hat ein Gespür für diese Herausforderung.
Die beiden Bücher sollten im deutschen Sprachraum Anlass für argumentativen Austausch sein. Doch die deutsche intellektuelle Provinz scheint Wiesenthal für einen Teil ihrer Museumskultur zu halten. Segevs Buch erschien zeitgleich in Hebräisch und Deutsch und wurde breit und wohlwollend rezensiert. Das hat es verdient; es ist über weite Passagen solide gearbeitet, gut geschrieben und zeigt bei alle Sympathie des Autors mit seinem Gegenstand einen versachlichten und vielschichtigen Wiesenthal. Bei allem Presselob ist aber die Kritik Walters an Wiesenthal, auf die Segev immerhin eingeht, unter den Tisch gefallen. Im englischen Sprachraum ist Wiesenthal von seinem Sockel gehoben, im deutschen steht er noch drauf. Diese Schieflage ist nicht das Ergebnis gebotener deutscher Sensibilität gegenüber dem Thema, sondern deutscher Verklemmtheit. Wenn österreichische und deutsche Intellektuelle sich ihrer Einstellung gegenüber den Juden und dem Staat Israel sicher wären, könnten sie sich guten Gewissens auf die Kritik der Bücher und öffentlichen Äußerungen Wiesenthals einlassen. Solange eine sachlich fundierte Kritik an einem jüdischen Autor reflexartig unter den Verdacht gerät, er könne der falschen Seite dienen, werden Menschen wie Wiesenthal zu Alibi-Juden, auf die man verweist, um die eigene politische Korrektheit zu belegen. Vom Nestbeschmutzer zum Vorzeigejuden – das hat Wiesenthal nicht verdient.
Man entmündigt Wiesenthal, wenn man ihn unter Naturschutz stellt, statt ihm das Recht zuzugestehen, in seinen Lebenserinnerungen zu flunkern wie die anderen auch. Heiligenverehrung ist der Versuch, die Schwächen eines bedeutenden Menschen zu retouchieren. Mir ist der Nestbeschmutzer Wiesenthal, der der Versuchung nicht widerstehen konnte, in die Kreise gefeierter Persönlichkeiten aufzusteigen, lieber als die kalte Marmorbüste, zu der er gemacht wurde.
[1]s. Heinz Schneppen: Odessa und das Vierte Reich… Berlin, Metropol 2007 und Heinz Schneppen: Ghettokommandant in Riga : Eduard Roschmann… Berlin, Metropol Verlag, 2009)
von Dieter Maier