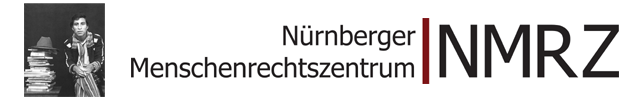Ineke Boerefijn, Laura Henderson, Ronald Janse and Robert Weaver (eds.): Human Rights and Conflict. Essays in Honour of Bas de Gaay Fortman, Cambridge/Antwerpen/Portland (Intersentia) 2012, 539 Seiten
Festschriften sind bekanntlich ein schwieriges Produkt. Alle sollen, alle wollen den Jubilar mitehren, in diesem Fall den niederländischen Wirtschaftsprofessor, Menschenrechtsforscher und Politiker Bas de Gaay Fortman, der maßgeblich an der Gestaltung des Menschenrechtsschwerpunkts der Universität Utrecht beteiligt war und für einen äußerst breiten interdisziplinären Ansatz in der Menschenrechtstheorie steht. Entsprechend groß ist die Bandbreite der 26 Aufsätze, die ihm unter dem Titel „Human Rights and Conflict“ gewidmet sind, wobei etliche Beiträge auch über dieses schon weite Themenfeld hinausgehen. Das Ergebnis ist, wie es eben bei Festschriften zu sein pflegt: Für jeden ist etwas dabei, aber ein roter Faden ist nicht zu finden. So nimmt sich der Rezensent die Freiheit, auf das hinzuweisen, was für ihn interessant scheint und einigermaßen originelle Ideen vorbringt.
Fangen wir mit der Formulierung eines zumindest in dieser Titulierung neuen Menschenrechts an: Das Recht auf Trauer – The Human Right to Mourning – das Antonius Robben aufgrund seiner Jahrzehnte langen Beschäftigung mit der argentinischen Militärdiktatur und den von ihr produzierten Traumata postuliert. Robben, Professor für Anthropologie an der Universität Utrecht und Verfasser einer wegweisen Studie über Argentinien „Political Conflict, Cultural Trauma, and Social Reconstruction“ betont die enorme, aber auch jeweils kulturspezifische Bedeutung von Bestattung, Totengedenken und der damit verbundenen Rituale für die betroffenen Menschen, aber auch die jeweilige Gesellschaft insgesamt. Daraus die Forderung auf ein eigenes Menschenrecht abzuleiten, ist provokant und derzeit wohl nicht sehr realistisch, aber gut geeignet, auf die Dimension des psychischen Schadens hinzuweisen, der durch die Praxis des gewaltsamen Verschwindenlassens angerichtet wird.
Robbens Vorschlag kann in gewisser Weise als konkretes Element einer „Transitional Justice“ gelesen werden. Dieser so ungeheuer erfolgreiche Modebegriff der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Unrechtsregimen der letzten Jahrzehnte ist explizit und implizit auch Gegenstand einer Reihe von Beiträgen im vorliegenden Band, sei es in Form von eng fokussierten Fallstudien oder in Auseinandersetzung mit den internationalen Strafgerichtshöfen. Sie fügen der ausgeuferten internationalen Diskussion nichts Wesentliches hinzu, und so ist es gut, dass der 2010 verstorbene Doyen der Utrechter Menschenrechtswissenschaft, Peter Baehr, noch Gelegenheit hatte, seine wohlbegründeten Skepsis gegenüber dem Begriff „transitional“ in das Plädoyer zu fassen, sie künftig in der wissenschaftlichen Diskussion zu vermeiden.
Sehr am Rande des Gesamttitels bewegt sich der Beitrag von Yvonne Donders, doch sein Gegenstand ist bemerkenswert. Die auch bei der UNESCO tätige Professorin der Universität Amsterdam untersucht den Begriff des „kulturellen Genozids“. Nach langen und intensiven Diskussionen fand er keinen Eingang in die Definition des Völkermords in der Konvention von 1948, aus der berechtigten Befürchtung, dass er den ohnehin unscharfen Tatbestand des Völkermords juristisch vollends unbrauchbar machen würde. Gleichwohl wird er bis heute immer wieder ins Feld geführt. Donders weist darauf hin, dass kulturelle Ansprüche von Minderheiten, Indigenen und anderen Gruppen heute gleichwohl umfassend geschützt sind, und zwar in einer ganzen Reihe von Menschenrechtsdokumenten und -verträgen, sowie im Humanitären Völkerrecht. Ihr Schluss, dass „kultureller Völkermord“ ein im Völkerrecht nicht existenter und auch aussichtsloser Begriff sei, ist plausibel.
Der Schutz ihrer Sprache und Kultur überhaupt ist auch ein wesentlicher Punkt in dem, was spätestens seit dem Ersten Weltkrieg das „Minderheitenproblem“ heißt. Im Menschenrechtsschutzsystem der Vereinten Nationen spielt es heute nur noch in Bezug auf die Rechte indigener Völker eine prominente Rolle. Natalie Sabanadze richtet konsequenter Weise den Blick auf ein wenig bekanntes Amt, den Hochkommissar für nationale Minderheiten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Seine Entstehung fällt nicht zufällig in den Zeitraum des Zerfalls des Ostblocks und der damit einhergehenden, vor allem aber nicht nur in Jugoslawien gewaltförmigen ethnischen Konflikte. Im Rahmen der OSZE versuchte das Büro des Hochkommissars daher die menschenrechtlichen Aspekte des Minderheitenschutzes von Anfang mit sicherheitspolitischen Aspekten zu verknüpfen. Mehr als anderes Menschenrecht sind die Rechte von Minderheiten daher auch in der OSZE immer politisch sehr flexibel gehandhabt worden. Inzwischen hat sich der Fokus der Staaten in der OSZE allerdings von den klassischen ethnischen Minderheiten auf Fragen der Integration von Migrationsbevölkerungen verschoben. Ein definitives Minderheitenrecht gibt es daher im Rahmen der OSZE bis heute nicht, und Sabanadze lässt anklingen, dass das auch nicht so schlecht ist.
Soweit einige Aufsätze, die dieser Rezensent in der bunten Palette des Bandes interessant fand. Wer sich ein vollständiges Bild mach will, kann das komplette Inhaltsverzeichnis auf http://www.intersentia.com/SearchDetail.aspx?bookid=102210 einsehen.
Rainer Huhle