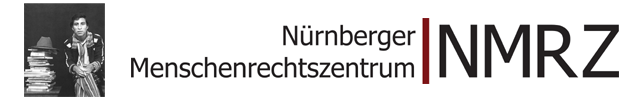Akhavan, Payam: Reducing Genocide to Law. Definition, Meaning, and the Ultimate Crime, Cambridge University Press 2012, ISBN 9780521824415, 191 Seiten
Schabas, William: Unimaginable Atrocities. Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, Oxford University Press 2012, ISBN 9780199653072, 232 Seiten
Ein iranischer und ein kanadischer Völkerrechtler haben die Möglichkeiten und Grenzen des internationalen Strafrechts aus unterschiedlichen Perspektiven neu beleuchtet. Gemeinsam ist ihnen die Frage nach den Erwartungen von Opfern und Öffentlichkeit an die internationalen Strafgerichtshöfe, nach deren Leistungsfähigkeit und Grenzen, und nach dem Verhältnis von politischer Wirkung und juristischen Schranken des internationalen Strafrechts.
Im Vorwort seines Buches macht Payam Akhavan auf eindrucksvolle Weise klar, worin die Bedeutung der Fragen liegt, die er dann im Folgenden in seiner rechtswissenschaftlichen Dissertation detailliert und gründlich behandelt. Als Angehöriger der Bahai-Religionsgemeinschaft hat er selbst die unerbittliche Verfolgung dieser Gruppe durch das iranische Regime erlebt, und auch später ist er immer wieder persönlich mit ähnlichen Verfolgungen von Angehörigen anderer Gruppen konfrontiert worden. Als Rechtsberater am Haager Jugoslawien-Tribunal hat er andererseits auch die juristischen Tücken der Anwendung des Genozidbegriffs durchgearbeitet, wie er in der Konvention von 1948 formuliert und dann in die Statuten der internationalen Gerichtshöfe übernommen wurde. Die Spannung, die zwischen der Erwartung der Opfer an „Anerkennung“ ihrer Verfolgung als Völkermord und den engen Definitionen dieses Begriffs in den Rechtstexten liegt, ist das Thema seines Buches, ein Thema, das bei fast allen großen Menschenrechtsverbrechen zutage tritt und auch in der inzwischen kaum noch zu übersehenden Literatur über „Völkermorde“ und in vielen Gerichtsverfahren seine Brisanz erweist, aber hier erstmals im Zentrum einer wissenschaftlichen Monografie steht. Anhand einiger signifikanter Beispiele illustriert Akhavan plastisch, zu welchen Verwerfungen in der Wahrnehmung und Beurteilung von Verbrechen es führen kann, wenn die Frage, ob sie als Völkermord zu qualifizieren seien oder nicht, im Vordergrund steht und alles überschattet. So z.B. bei der Entscheidung der UN-Untersuchungskommission und später des IStGH darüber, ob die Morde in Darfur Völkermord darstellten oder nicht, oder beim Ruanda-Gerichtshof, ob bestimmte Angeklagte Völkermord oder/und andere Verbrechen begangen hatten. Fällt das Urteil negativ aus, ist die Empörung groß. Der UN-Kommission zu Darfur half es ebenso wenig wie später der ersten Instanz des IStGH, dass sie erklärten, die Bezeichnung der dort zweifelhaft begangenen Taten als Verbrechen gegen die Menschheit mache sie nicht weniger schlimm und gravierend. Genozid oder Völkermord gilt Vielen als das schlimmste aller Verbrechen, das „Crime of Crimes“, und wer darunter bleibt, gerät in den Verdacht der Verharmlosung. Dabei ist in den Verbrechenstatbeständen der internationalen Gerichtshöfe der Völkermord eines unter mehreren schweren Verbrechen, die international geahndet werden sollen, eine Rangstufung gibt es da nicht.
Allerdings zeigt ein Blick auf die Geschichte, den Payam Akhavan in einem späteren Kapitel auch gründlich wirft, dass in der Vorstellung vor allem von Raphael Lemkin, dem allgemein als Urheber des Begriffs und „Vater der Konvention“ anerkannten polnisch-jüdischen Juristen, das Verbrechen des Völkermords doch so etwas wie das ultimativ Böse, eben das schlimmste Verbrechen überhaupt beschreiben und ächten sollte. Für Lemkin bestand der Kern dieses besonders schlimmen Verbrechens im Versuch, nicht nur einzelne Menschen zu töten, sondern ganze Bevölkerungsgruppen zu vernichten. Dabei ging es Lemkin, obwohl viele Mitglieder seiner Familie selbst Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung waren, nicht nur um den Holocaust. Die Konvention sollte den Völkermord grundsätzlich und überall ächten und seine Verfolgung erreichen.
Viele von Lemkins Zeitgenossen sahen dieses Bemühen aber auch skeptisch. Der britische Ankläger im Nürnberger Prozess etwa bezweifelte nicht nur, dass mit einer solche Konvention praktisch etwas erreicht werden könne – die Geschichte der folgenden vier Jahrzehnte sollte ihm Recht geben – sondern sah auch die Gefahr, dass mit der Hervorhebung eines einzigen Verbrechenstatbestands in einer eigenen Konvention im Grund ein Rückschritt im Völkerstrafrecht erfolge, das seit Nürnberg bereits weitere Verbrechen, insbesondere die unter die „Verbrechen gegen die Menschheit“ fallenden, für international zu verfolgen und zu bestrafen erklärt hatte. Andere, wie z.B. Hannah Arendt fragten sich, ob eine dürre Rechtsformel überhaupt geeignet sei, die unfassbaren Verbrechen etwa der Nazis adäquat zu erfassen. Und nicht zuletzt wurde schon damals, und wird bis heute die Frage gestellt, warum die Vernichtung bestimmter, aber eben nicht aller Gruppen von Menschen in so besonderer Weise gegenüber anderen als besonders verdammenswert hervorgehoben werden müsse. Die Frage nach den Kriterien für die von der Völkermord-Konvention besonders geschützten Gruppen wurde in den vierziger Jahren unterschiedlich beantwortet und ist bis heute ein wesentlicher Kritikpunkt an der Konvention.
All dies ist in der wissenschaftlichen und populären Literatur vielfach diskutiert worden, und auch Akhavan geht selbstverständlich in seiner Studie darauf ein. Gerade in der Frage, mit welchem Recht man eine solche Hierarchisierung von Massentötungsverbrechen einführen konnte und sie auch in den derzeitigen Gerichtshöfen teilweise aufrecht erhält, spitzt Akhavan seine Überlegungen in origineller und überzeugender Weise zu. Gestützt auf kriminologische Erkenntnisse und auf viele einschlägige Gerichtsurteile zeigt er, dass mit der Hierarchisierung von Verbrechen immer auch Abstufung der Strafe verbunden sein muss. Das entspricht sowohl der Gesetzgebung in aller Welt wie auch dem üblichen Rechtsempfinden. Je schlimmer das Verbrechen, desto härter die Strafe, und auch umgekehrt: Je härter eine Strafe ausfällt, desto schlimmer muss wohl das Verbrechen gewesen sein. Genau dies ist aber beim Völkermord nicht der Fall. Am Strafmaß zeigt sich, dass die Behauptung etwa des Jugoslawiengerichtshofs, dass es im Völkerstrafrecht heute eine Rangfolge von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit und schließlich weniger ernsten Verbrechen gebe, insofern irrelevant ist, als in den beiden ersten Fällen die Höchststrafe zu verhängen ist. Der Unterschied liegt also in der symbolischen Aufladung und der moralischen Bewertung. Hier lässt Akhavan keinen Zweifel an seinem Unbehagen, zumal die Kriterien für die Unterscheidung zwischen beiden Verbrechenstatbeständen so schwierig zu bemessen sind, wie die ganze Geschichte der internationalen Strafrechtsprechung schon gezeigt hat und wie sie von vielen Autoren immer wieder in Frage gestellt worden sind. Am Beispiel einer Reihe von Urteilen des Ruanda-Gerichtshofs, des Jugoslawiengerichtshofs und des IStGH zeigt Akhavan überzeugend auf, in welche komplexen Fragestellungen sich die Gerichte begeben müssen, um Völkermord von anderen Verbrechen abzugrenzen: Ist die verfolgte Gruppe eine im Sinne der Konvention, also eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe? Welche Absicht hatten die Angeklagten? Und genügt schon die Absicht? Diese und viele weitere damit verbundene Fragen sind nicht nur häufig kaum objektiv zu beantworten, sie wären auch gar nicht nötig, wie schon Shawcross feststellte, bestünde man nicht auf der besonderen Hervorhebung des Völkermords.
Akhavan führt mit großer Sachkenntnis und gestützt vor allem auf die Analyse zahlreicher Verfahren die Probleme des Rechtsbegriffs „Genozid“ und des ihn immer begleitenden populären Verständnisses von Völkermord als schlimmstem aller Verbrechen vor. Zu Recht sieht er in der Inkongruenz beider Begriffe das vielleicht größte Problem im Hinblick auf die Rolle des internationalen Strafrechts als Hüter von allgemein anerkannten Maßstäben von Gerechtigkeit. Da ist es dann am Ende ein bisschen enttäuschend, dass er seine übers Buch verstreuten klaren Meinungsäußerungen am Ende nicht zu einer Stellungnahme zusammenfasst, wie er sich eine Reform oder verbindliche Interpretation der entsprechenden Rechtsnormen vorstellt. Stattdessen flüchtet er sich im Schlusskapitel auf doch recht allgemeine moralische, literarisch unterfütterte Aussagen über die Begrenztheit des Rechts. Gleichwohl ist sein Buch in der Fülle der Literatur über die Problematik des Völkermord-Begriffs eine über weite Strecken originelle und stringente Darstellung, der man auch deswegen sehr gerne folgt, weil bei der Lektüre immer wieder durchscheint, wie sehr sich der Autor mit den aufgeworfenen juristischen Fragen auch moralisch auseinandersetzt.
Zu denjenigen Autoren, die sich besonders intensiv mit der Geschichte der Völkermord-Konvention und der weiteren Entwicklung des Konzepts bis hin zur Anwendung in den internationalen Strafgerichtshöfen beschäftigt haben, gehört der kanadische Völkerrechtler William Schabas, auf den natürlich auch Akhavan in seinem Buch eingeht. Schabas hat in vielen Schriften zwar die Probleme des Völkermordbegriffs benannt, die Konvention aber immer als einen der großen Erfolge des internationalen Menschenrechtsschutzes und insbesondere des Völkerstrafrechts betrachtet. In seinem neuen Buch Unimaginable Atrocities findet sich jedoch ein Kapitel unter der Überschrift „The Genocide Mystique“, in dem Schabas den Begriff skeptischer als in früheren Schriften zu sehen scheint. Ähnlich wie Akhavan bemerkt er kritisch de „rhetorische Macht des G-Worts“ (also des Genozid-Begriffs) und die schwarze Magie oder „Mystik“, die ihm anhaftet und unter anderem seine enorme mediale Durchschlagskraft verleiht – weswegen auch so viele Opfer politischer Verbrechen sich bemühen, dass das ihnen Geschehene als Völkermord „anerkannt“ wird. Schabas bleibt dann allerdings doch bei seiner im Grundsatz positiven Würdigung der Genozid-Konvention und der auf ihr basierenden Rechtsprechung. Er folgt sogar Lemkins biologistisch-essentialistischer Begründung für die Privilegierung nationaler, ethnischer und religiöser Gruppen in der Konvention, wonach solche Gruppen ähnlich wie gefährdete Tier- und Pflanzenarten wegen ihrer Bedeutung für die Menschheit insgesamt besonders geschützt werden müssten. Auf manche politische Gruppen, fügt Schabas nonchalant hinzu, könne man hingegen ja wohl gern verzichten. Auch seine an dieser Stelle notwendig knappen Anmerkungen dazu, wie die politischen Gruppen in der Diskussion in der UNO 1947/48 außen vor blieben, dürfen hinterfragt werden. Gleichwohl gelingt es Schabas in diesem Kapitel, alle wichtigen Aspekte und Probleme des Genozid-Begriffs präzise zu benennen. Am Ende des Kapitels überrascht der Autor dann sogar mit einer erneuten Relativierung des Begriffs, wenn er zustimmt, dass „Völkermord“ heute eigentlich angesichts des immer klarer bestimmten Rechtsbegriffs der „Verbrechen gegen die Menschheit“ unter diesen gefasst werden könne, wenngleich er dann seine „Mystik“ verlöre.
Einen weiteren Begriff, der bereits lange vor Lemkins Erfindung des Worts „Genozid“ im Völkerrecht kursierte, im Nürnberger Prozess gängige Münze war, und der bis heute vor allem im US-amerikanischen Diskurs geläufig ist, führt Schabas an dieser Stelle auch ein: die „crimes of atrocity“, die ja auch im Titel seines Buches aufscheinen. Der titelgebende Begriff „unimaginable atrocities“ entstammt der Präambel des Römischen Statuts des IStGH. Die Rede von „atrocities“ hat jedoch im Völker(straf)recht eine lange Geschichte. Bei der Vorbereitung des Nürnberger Prozesses sprach man von „atrocities and persecutions“, ehe man sich auf den Begriff „Crimes against humanity“ verständigte, aber auch schon die internationale Empörung über die Ermordung großer Teile der armenischen und anderer Bevölkerungen im osmanischen Reich bediente sich des Begriffs. Zu Recht weist Schabas im ersten Kapitel dieses Buches, das sich mit den wesentlichen Charakteristika von Verbrechen beschäftigt, die sie zu international verfolgbaren machen, auf das Paradox hin, dass gerade der Nürnberger Prozess, in dem solche „atrocities“ erstmals vor einem internationalen Gericht verurteilt wurden, dieser Dimension durch die restriktive Bezeichnung der Angeklagten als „Hauptkriegsverbrecher“ gerade nicht gerecht wurde.
Die weiteren sieben Kapitel des Buches wenden sich jeweils einem wichtigen – und meist kontroversen – Problembereich der internationalen Strafjustiz zu. Schabas erweist sich dabei als ein Meister in der Kunst, komplexe juristische Probleme so schlüssig dazustellen, dass die Lektüre bisweilen geradezu spannend gerät. Sein Kapitel über „Siegerjustiz?“ etwa gliedert zunächst diesen meist nur polemisch gebrauchten schwammigen Begriff in seine rationalen Bestandteile auf und zeigt dann, wie er tatsächlich kritisch gegen den Nürnberger Prozess zu wenden ist. Mit gleicher Unbefangenheit untersucht er die Fragen nach der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit auch bei den seitherigen internationalen Gerichtshöfen und zeigt, dass diese Ideale auch heute nicht vollständig erreicht sind, nicht einmal beim IStGH, dem einzigen Gerichtshof, der pro forma von politischen Direktiven frei ist. Schabas stellt die provokante Frage, ob das Verlangen nach einer wirklich unabhängigen internationalen Strafjustiz nicht eine Illusion ist, der man gar nicht nachhängen sollte. Ähnlich souverän zergliedert Schabas in dem Kapitel „Nullum Crimen sine lege“ die Fragen des Rückwirkungsverbots, die sich in Nürnberg ja insbesondere an den „Verbrechen gegen die Menschheit“ festmachten, da diese „Crimes against Humanity“ noch nicht ähnlich fest wie etwa die Kriegsverbrechen kodifiziert oder als Jus cogens anerkannt waren.
Dem Verhältnis von Wahrheit und Gerechtigkeit geht Schabas in einem weiteren Kapitel nach. Überzogene Erwartungen an den Ertrag historischer Wahrheit , wie sie seit Nürnberg immer wieder an Gerichte formuliert wurden, weist Schabas zurück und insistiert auf dem Unterschied zwischen historischer und juristischer Wahrheitsfindung. Die Aufteilung dieser beiden Modalitäten der Wahrheitsfindung auf Gerichte einerseits und eigene „Wahrheitskommissionen“ andererseits, wie sie seit einigen Jahrzehnten um sich gegriffen hat, begrüßt Schabas, leugnet jedoch nicht die Probleme, die daraus entstehen, wenn sich dann zwei – möglicherweise nicht nur unterschiedliche, sondern sogar konträre – „Wahrheiten“ gegenüberstehen. Schließlich gibt es inzwischen auch ein „Recht auf Wahrheit“ für die Opfer von Menschenrechtsverbrechen. Etwas am Rande geht Schabas in diesem Kapitel auch noch auf die Frage nach der rechtlichen Bedeutung allgemein anerkannten oder anzuerkennenden historischer Wahrheiten ein. Die Frage stellt sich einmal im Hinblick auf das, was Gerichte ohne eigene Beweiserhebung als allgemein anerkannte Erkenntnisse würdigen können, und inwieweit Gesetzgeber und Justiz solche allgemein anerkannten Wahrheiten auch gegenüber „Leugnern“ durchsetzen dürfen. Schabas will jedenfalls sichergestellt wissen, dass niemand die ständige Neubetrachtung und Neubewertung der Vergangenheit, die ein elementarer Bestandteil historischer Wissenschaft sind, in Frage stellen darf.
Ein letztes Beispiel aus der Reihe dieser rechtspolitischen Essays, die durchaus einzeln gelesen werden können und dennoch einen roten Faden aufweisen, sei herausgegriffen: Unter dem wiederum griffigen Titel „No Peace Without Justice?“ stellt sich Schabas der heiklen Frage nach der Zulässigkeit von Amnestien für schwere Menschenrechtsverbrechen. Hier bietet sich der bemerkenswerte Anblick eines Rechtsgelehrten, der sich vor allem im Bereich des Völkerstrafrechts profiliert hat und zu dessen Verständnis und Verbreitung viel beigetragen hat, der hier aber entschieden gegen den Strom schwimmt, wenn er die heute vorherrschende Meinung in Frage stellt, wonach Amnestien für Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord nicht mehr erlaubt seien. Diese Ansicht weist er, trotz zahlreicher entsprechender Entscheidungen internationaler Gerichte und Äußerungen vieler Experten der Vereinten Nationen, zurück. Dass er sich dabei vor allem auf das Zweite Zusatzprotokoll der Genfer Konvention beruft, das selbst vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz heute im Licht neuerer Rechtsentwicklungen nicht mehr so wörtlich interpretiert wird, ist etwas erstaunlich. Die eigentliche Frage ist jedoch, auch für Schabas, ob es angesichts des stetigen Verlangens der Opfer nach „Gerechtigkeit“, also nach Bestrafung der Schuldigen, wünschenswert und sinnvoll ist, die ohne Zweifel vorhandene generelle Tendenz zu einem Verbot der Straflosigkeit schwerer Menschenrechtsverbrechen bis hin zu einem völligen Verbot von Amnestien zu vollenden. Die Diskussion hat sich immer wieder an etlichen Beispielen, die auch Schabas kurz anreißt, entzündet, wie am „südafrikanischen Weg“, dem Lomé-Abkommen in Sierra Leone oder an den Kontroversen um die Verfolgung der ugandischen „Lord‘s Resistance Army“ durch den IStGH. Schabas stellt nicht nur das rechtliche Verbot von Amnestien in Frage, sondern auch das zentrale Argument, dass Amnestien von schweren Verletzungen der Menschenrechte keine Grundlage für einen dauerhaften Frieden sein könnten. Am Ende will er sich dann aber doch nicht festlegen und plädiert für flexible, nicht rigide Antworten. Man muss Schabas‘ Argumentation gerade in diesem Kapitel nicht folgen und wird es trotzdem wertschätzen können, dass ein so sehr aus dem Studium des internationalen Strafrechts kommender Jurist sich den grundlegenden Fragen dieser Disziplin neu stellt und sich nicht scheut, die gängigen Antworten auf den Prüfstand zu stellen. Wenngleich mit überwiegend weit weniger kontroversen Resultaten ist das auch die Methode und das Verdienst des ganzen Bandes. Da er zudem ausnehmend lebendig geschrieben ist, sollte der Band ebenso wie Payam Akhavans wichtige Studie über den Völkermord-Begriff eine breite Leserschaft finden.
Rainer Huhle