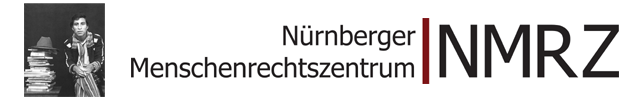Lewis, Mark: The Birth of the New Justice. The Internationalization of Crime and Punishment, 1919-1950, Oxford UP 2014, 346 Seiten
Mit The Birth of the New Justice fügt der US-amerikanische Historiker Mark Lewis der stark anwachsenden Literatur über die Geschichte von Idee und Praxis internationaler Strafgerichtsbarkeit – denn dies verbirgt sich hinter dem etwas gequält originellen Begriff „New Justice“ – ein eindrucksvolles weiteres Buch hinzu. Dabei schlägt er in acht dichten Kapiteln den Bogen von ersten Entwürfen im neunzehnten Jahrhundert bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dem ersten Kapitel über die Vorläufer im 19. Jahrhundert, in dem Lewis auf einige Völkerrechtler und vor allem ihre damals entstehenden internationalen Verbände eingeht, folgt eine Studie über die gescheiterten Versuche, nach dem Ersten Weltkrieg völkerrechtliche Sanktionen gegen einzelne Verantwortliche zu verhängen. Hier geht Lewis ausführlich auf die Arbeit der „Commission of Responsibilities“ ein, eines Beraterstabs der Pariser Friedenskonferenz, in deren Verhandlungen eine Reihe von Konzepten erstmals formuliert wurden, auf die sich spätere Entwürfe internationalen Strafrechts immer wieder beriefen. In der „Commission of Responsibilities“ wurde die Frage strafrechtlicher Verantwortlichkeit für einen Angriffskrieg debattiert, sie sammelte Beweise für Kriegsverbrechen mit Blick auf künftige Prozesse, und sie sollte die Frage persönlicher strafrechtlicher Verantwortlichkeit auch von höchsten Amtsträgern klären, einschließlich des Problems der Verantwortung durch Unterlassung, also das Nicht-Verhindern von Verbrechen. Und schließlich sollte sie auch Vorschläge erarbeiten, vor welcher Art von Gericht solche Taten verhandelt werden sollten. Diese Agenda ging weit über das hinaus, was damals politisch möglich war, und so wurden mögliche Ergebnisse ihrer Arbeit in den politischen und auch juristischen Differenzen zwischen den Mächten, die sie geschaffen hatte und teilweise auch unter ihren eigenen Mitgliedern zerrieben. Gleichwohl arbeiteten hier einige der bekanntesten Rechtsgelehrten der Zeit mit und entwickelten Rechtskonzepte, die später wieder aufgegriffen wurden. Lewis geht den Positionen einzelner Gelehrter in diesem Kontext auf der Basis des Archivs des Völkerbunds detailliert nach und kann dabei die unvermeidliche Vermengung juristischer und politischer Argumentationen nachweisen, zumal die meisten dieser Juristen ja auch politische Funktionen bekleideten.
Im dritten Kapitel geht Lewis zwei Hauptfragen näher nach, die in den Debatten in der „Commission of Responsibilities“ ausgiebig diskutiert wurden und wegweisend für die späteren Rechtsbegriffe der „Verbrechen gegen die Menschheit“ und des „Völkermords“ wurden. Die Begriffe „Crimes against humanity and civilization“ bzw. „Crime of denationalization” wurden in der „Commission of Responsibilities“ und in den Friedensverhandlungen vor allem von den Vertretern der Armenier (die allerdings keinen offiziellen Status am Verhandlungstisch hatten) und von Serbien und Griechenland eingeführt. Die Forderungen nach einer völkerstrafrechtlichen Ahndung dieser Verbrechen stießen sich allerdings mit der völkerrechtlichen Verankerung des Minderheitenschutzes durch den entstehenden Völkerbund, wo die Frage des Minderheitenschutzes auf die ausschließlich politische Ebene verlagert wurde. Renommierte Rechtsgelehrte wie Nicolas Politis oder Rolin-Jaequemyns gingen damals schon sehr weit in der Forderung nach internationaler Strafverfolgung solcher Verbrechen. Doch Lewis zeigt auch, am Beispiel vor allem von Politis, wie rasch solche Positionen ins Wanken geraten konnten aufgrund der politischen Interessen, in die auch viele der Gelehrten eingebunden waren.
Das nächste Kapitel geht dann den gescheiterten Versuchen nach, in der Folge des Weltkriegs im Rahmen der erhofften neuen Weltordnung auch einen Völkerstrafgerichtshof zu errichten. Auch hier präsentiert Lewis zum einen die – oft unausgegorenen und sogar in sich widersprüchlichen – Ideen etlicher Rechtsgelehrter, aber auch die institutionellen Ansätze innerhalb von Organisationen wie dem Völkerbund oder dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Gewichtige Rollen spielten mittlerweile auch die internationalen Fachverbände International Law Association (ILA) und Association Internationale de Droit Pénal (AIDP). Hugh Bellot von der ILA und Vespasien Pella von der AIDP legten jeweils Statutenentwürfe für einen solchen Gerichtshof vor, dazu gab es zahlreiche modifizierte Vorschläge, was die international anzuklagenden Tatbestände, die Struktur und die Kompetenzen eines solchen Gerichtshofs betraf. Nichts davon wurde verwirklicht, doch Lewis macht deutlich, wie viele der damals diskutierten Ideen nach 1945 wieder aufgegriffen wurden und auch, welche personellen Kontinuitäten bestanden. Der rumänische Strafrechtler Vespasien Pella etwa, dessen umstrittene Persönlichkeit Lewis angemessen darstellt, war nach dem 2. Weltkrieg eines der prägenden Mitglieder der Völkerrechtskommission der UNO. Der weltweit renommierte französische Strafrechtler Henri Donnedieu de Vabres, ein weiteres prominentes Mitglied der AIDP, war der französische Richter am IMT in Nürnberg und setzte sich nach Nürnberg weiterhin kritisch mit den Prinzipien internationaler Strafgerichtsbarkeit auseinander.
Wenn es aus heutiger Sicht scheinen mag, dass die Idee internationaler Strafgerichtsbarkeit eine progressive sei, eng verbunden mit dem Kampf für Menschenrechte, so macht Lewis deutlich, dass nicht nur viele der Pioniere dieser Idee politisch äußerst konservativ waren, sondern dass auch die Konzepte für internationale Strafgerichtsbarkeit zwar implizit staatliche Souveränität in begrenztem Umfang in Frage stellen mussten, aber letztlich doch vor allem auf deren Erhalt zielten. Das einzige konkrete Ergebnis der Bemühungen um internationale Strafjustiz war Ende der zwanziger Jahre eine internationale Konvention gegen Geldfälscherei. Im fünften Kapitel geht Lewis dann auf einen weiteren Strang im Bemühen um internationale Gerichtsbarkeit ein, den Kampf gegen den Terrorismus, der 1937, als es mit dem Völkerbund schon zu Ende ging, zu einer internationalen Konvention gegen den Terrorismus führte. In der Politik und in der Gelehrtenrepublik wurde der Kampf gegen die „gemeinsame Gefahr“ des Terrorismus in Begriffen wie der „Abwehr sozialer Gefahren“ für die Staatenwelt geführt. Für Pella z.B. gehörten zu diesen sozialen Gefahren Mafiaorganisationen ebenso wie Gewerkschaften. Das „Committee for the Repression of Terrorism“, das innerhalb des Völkerbunds die Konvention vorbereitete, nahm von den staatsterroristischen Praktiken Italiens oder Deutschlands keine Notiz, ein entsprechender Vorstoß des ins Exil getriebenen SPD-Parlamentariers Otto Wels wurde vom Committee nicht einmal beantwortet. Umgekehrt verweist Lewis auf eine Reihe von guten Arbeitskontakten zwischen den Promotoren der Konvention und dem faschistischen Italien sowie NS-Juristen, obgleich Deutschland längst aus dem Völkerbund ausgetreten war. Ausgerechnet im Kontext dieser politisch fragwürdigen Konvention wurde auch zum ersten Mal ein Vertrag über einen internationalen Strafgerichtshof aufgelegt, der für Terroristen gedacht war, die sich nationalen Gerichten entzogen. Mangels ausreichender Ratifizierungen wurde er allerdings nicht geschaffen. Der Zweite Weltkrieg beendete dann ohnehin all diese Pläne.
Mit diesem wenig ermutigenden Blick auf die Geschichte der Bemühungen um internationale Strafgerichtsbarkeit vor dem Zweiten Weltkrieg endet die erste Hälfte von Lewis‘ Darstellung. Im sechsten Kapitel macht er dann einen Sprung mitten hinein in die Debatten während des Zweiten Weltkriegs, als sich die ungeheuerliche Qualität der NS-Verbrechen allmählich abzeichnete und zahlreiche Impulse für einen neuen Anlauf hin zu internationaler Aburteilung solcher Verbrechen freisetzte. Das erste Beispiel, dem das sechste Kapitel gewidmet ist, sind die juristischen Strategien, die innerhalb des World Jewish Congress (WJC) und seines „Institute of Jewish Affairs“ während des Krieges und danach entwickelt wurden, um die NS-Verbrechen international zu verfolgen. Lewis überschreibt dieses Kapitel als die „Suche nach einem opfer-orientierten Ansatz neuer Gerechtigkeit“ und versteht die jüdischen Forschungen und Handlungsvorschläge als Kontrapunkt zu den Konzepten aus der Vorkriegszeit, die wesentlich vom Gedanken staatlicher Stabilität getragen gewesen seien. Die jüdischen Gelehrten des Instituts wie Jakob Robinson oder Franz Bienenfeld brachten sich aktiv in die internationalen Debatten und auch in das institutionelle Geflecht ein, das während des Kriegs im Hinblick auf eine künftige Bestrafung der NS-Verbrechen entstand, insbesondere in die Diskussionen der „UN War Crimes Commission“ (UNWCC) und die Instanzen der US-Regierung, in denen die späteren Nürnberger Prozesse vorgedacht wurden. Mit Blick auf die angestrebte Bestrafung der NS-Täter gab es innerhalb und außerhalb der jüdischen Rechtswissenschaftler verschiedene Strategien. Entscheidend war dabei bereits, wie sich später in Nürnberg herausstellen sollte, die Definition der NS-Verbrechen. War die Vernichtung der Juden ein eigenständiges Verbrechen, oder diente sie dem Endziel des Eroberungskrieges? Solche Fragen waren nicht nur faktisch-historisch zu klären, sondern hatten auch gewichtige strategische Konsequenzen. Innerhalb des WJC und des Instituts gab es darüber verschiedene Ansichten. Robinson, der offensichtlich erahnte, wohin die Entwicklung in Nürnberg gehen würde, wollte die Vernichtung der Juden als Mittel zur Schaffung einer schlagkräftigen deutschen Kriegsmaschinerie, somit als Element der Verbrechen des Angriffskriegs und von Kriegsverbrechen verstehen und auf diese Weise auch die Judenverfolgung vor dem Krieg mit einbeziehen. Bienenfeld und andere wollten sie als kriegsunabhängiges „Crime against Humanity“ verstanden wissen und sie entsprechend im Rahmen eines neuen Begriffs von universellen Verbrechen gegen die Menschheit verhandeln. Unterschiede gab es auch hinsichtlich der Bemühungen, sich in die entstehenden Institutionen einzubringen. Sollten die dokumentarischen Beweise, die der WJC über die Vernichtung der Juden sammelte, direkt als Teil des Materials über Kriegsverbrechen in die UNWCC eingebracht werden, oder sollte das Institute seine Ergebnisse unabhängig dokumentieren? Und sollte man in Nürnberg auf einem eigenen Anklagepunkt für die Verbrechen gegen das jüdische Volk bestehen oder diese Verbrechen in das in London verabschiedete Anklagegerüst einbringen? Lewis seziert die verschiedenen Positionen zu diesen und anderen bedeutsamen rechtspolitischen und –strategischen Fragen mit detaillierter Quellenkenntnis, und doch immer im Blick auf die daraus erwachsenden Konsequenzen für die Herausbildung der „new justice“ nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Praxis wechselten die verschiedenen Positionen innerhalb der jüdischen Verbände und auch im Lauf der Zeit. Auch die Bewertung des schließlich in Nürnberg Erreichten fiel innerhalb der jüdischen Juristen und Rechtspolitiker durchaus unterschiedlich aus. Zumindest Jakob Robinson zeigte sich jedenfalls zufrieden.
Ganz anders Raphael Lemkin, um dessen Begriff des „Völkermords“ und der auf ihm basierenden Konvention von 1948 es in Lewis‘ vorletztem Kapitel geht. Über Lemkin und die Geschichte und Begrifflichkeit der Völkermord-Konvention ist in den letzten Jahren eine Flut von Literatur erschienen, häufig extrem auf die Figur Raphael Lemkins und seinen einsamen Kampf konzentriert. Lewis relativiert in diesem Kapitel einiges davon. Er ruft die Rolle, die auch andere Juristen wie Pella und de Vabres bei der Ausarbeitung der Konzeption spielten, ebenso in Erinnerung wie die teils bitteren Kontroversen, die zwischen diesen Juristen ausgetragen wurden. Er ruft auch in Erinnerung, wie viele prominente Juristen schon damals die Definition des Völkermords in der Konvention und die vorgesehenen Mittel zu seiner Verhütung und Bestrafung in Zweifel zogen, und zeichnet die politischen Grabenkämpfe nach, in denen Lemkin kaum ein Mittel scheute, um sein Projekt durchzusetzen. Schließlich bindet Lewis in diesem langen Kapitel die Geschichte der Völkermord-Konvention auch wieder an die Frage nach einem internationalen Strafgerichtshof zurück, der ja in der Konvention als eine theoretische Möglichkeit für die Bestrafung des Völkermords vorgesehen ist, aber nie eingerichtet wurde. Er verweist auch darauf, dass die Völkermord-Konvention in Konkurrenz zu dem ebenfalls von der UNO betriebenen Projekt eines Völkerstrafgerichtshof und eines Völkerstrafgesetzbuchs stand, das in der von Lemkin ungeliebten Völkerrechtskommission entwickelt wurde, freilich auch ohne je das Stadium der Verwirklichung zu erreichen. Letztlich wurden diese konkurrierenden Ideen der Nachkriegszeit, die Völkermord-Konvention und die in der Völkerrechtskommission weiterentwickelten Nürnberger Prinzipien erst in den internationalen Strafgerichtshöfen am Ende des Jahrhunderts zusammengeführt, worauf Lewis in seinen abschließenden Bemerkungen aber nur noch kursorisch eingeht.
In seinem letzten substantiellen Kapitel führt der Autor noch einmal auf ein Gleis, das eher selten im Kontext der internationalen Strafjustiz beachtet wird: die Überarbeitung des Kriegsvölkerrechts aus der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg durch die neugefassten Genfer Konventionen von 1949 und vor allem die damals neu geschaffene Vierte Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die Arbeit an der Neufassung Haager und Genfer Kriegsvölkerrechts begann 1946, also zeitgleich zu den Nürnberger Prozessen, und am Verhandlungstisch in Genf bzw. Stockholm saßen u.a. die gleichen Mächte wie in Nürnberg, allerdings vertreten durch teilweise sehr anders denkende Repräsentanten. Dennoch konnte auch beim Kriegsvölkerrecht bzw. dem „humanitären Völkerrecht“ – ein Terminus, der übrigens in den Genfer Konventionen noch nicht vorkommt – die Frage nach den Konsequenzen von Verstößen gegen dessen Bestimmungen nicht außen vor bleiben. Erstmals, und gegen Widerstand etlicher Staaten, aber auch aus dem IKRK, wurden in die neuen Genfer Konventionen Bestimmung aufgenommen, wonach die Vertragsparteien sich verpflichten, „alle notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine der […] schweren Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl erteilen.“ (So der Wortlaut von Art. 146 der 4. Genfer Konvention; entsprechende Artikel finden sich auch in den übrigen drei Konventionen.) Zu Recht betont Lewis den geradezu revolutionären Charakter dieser Bestimmungen, denn bis dahin waren Kriegsverbrechen zwar international geächtet, es war aber ausschließlich den Staaten überlassen, ob und wie sie sie ahndeten. Die ebenfalls in die Debatten eingeführte Forderung nach einem internationalen Strafgerichtshof für schwere Verstöße gegen das Kriegsrecht setzte sich allerdings genau so wenig durch wie auf den anderen Verhandlungsbühnen der „new justice“. Lewis vermag auch hier detailliert anhand der Quellen des IKRK und diplomatischer Quellen der beteiligten Staaten zu zeigen, wie komplex die Verhandlungen waren, und dass die Frage der Strafbarkeit von Kriegsverbrechen einer unter zahlreichen anderen Punkten waren, in denen sowohl klassische Fragen des Kriegsrechts wie neuere, aus der Menschenrechtsdiskussion kommende Fragen wie etwa das Diskriminierungsverbot auszuhandeln waren. Im Hintergrund, auch das macht Lewis deutlich, stand außerdem die problematische Geschichte der internationalen Rotkreuzbewegung während des Krieges, insbesondere gegenüber Italien und Deutschland, die innerhalb des IKRK keineswegs aufgearbeitet war. Während der dreijährigen Verhandlungsgeschichte der Konventionen gab es durchaus weitgehende Vorschläge bezüglich der Bestrafung von Kriegsverbrechen. Nach der Stockholmer diplomatischen Konferenz 1948 setzte das IKRK eine Arbeitsgruppe ein, der unter anderem Jean Graven und Hersch Lauterpacht angehörten. Gemäß den Vorstellungen dieser hochrangigen Juristen sollten sich die Staaten in den neuen Genfer Konventionen u.a. dazu verpflichten, Verstöße gegen das Humanitäre Völkerrecht als Straftatbestände in ihre nationalen Strafgesetzbücher aufzunehmen, die zu bestrafenden Verstöße einzeln als Verbrechen aufzuführen, sowie die Berufung auf Befehlsgehorsam oder den Konventionen zuwiderlaufende Gesetze als Grund für Straffreiheit auszuschließen. Doch diese Vorschläge, die eine Brücke zu den Nürnberger Prinzipien hätten bilden können, wurden von den Staaten 1949 in Genf verworfen, es blieb bei dem eher unbestimmt formulierten, oben zitierten Aufruf zu Strafbestimmungen.
Im Schlusswort seines Buches spinnt der Autor die Geschichte seiner „new jsutice“ dann noch etwas weiter, geht auf die Arbeiten der Völkerrechtskommission ein und streift die Entwicklung bis hin zum Internationalen Strafgerichtshof, macht aber auch klar, dass er sein Buch als eine „Geschichte der Entwicklung des internationalen Strafrechts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ verstanden wissen will. Dieser Anspruch freilich ist zumindest missverständlich. Denn die acht Kapitel dieses Buches beleuchten einzelne Momente dieser Entwicklung, und dankenswerter Weise gerade auch solche, die nicht immer im Blick sind, wenn man die Geschichte des Völkerstrafrechts betrachtet. Diese Kapitel sind kleine Monographien, die größtenteils außerordentlich gründlich auf der Basis von archivalischen Quellen recherchiert sind und viele neue Einsichten bringen. Doch ihre Summe macht sie nicht zu einer Geschichte des Völkerstrafrechts, eher zu einem ausführlichen kritischen Kommentar auf viele dieser Geschichten des Völkerstrafrechts. So fehlt dem Buch z.B. ein Kapitel über das zentrale Ereignis in der Geschichte des Völkerstrafrechts, den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, dafür wirft Lewis in dem Kapitel über die jüdischen Anstrengungen, die Opferperspektive einzubringen, einen kritischen Seitenblick auf das IMT, der in den Geschichten dieses Prozesses meist bestenfalls am Rande gestreift wird. Lewis‘ Buch sollte man gerade nicht als „Geschichte des Völkerstrafrechts“ lesen, sondern daraus lernen, dass es eine glatte, kontinuierliche Entwicklung von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis hin zum ICC eben nicht gibt. Die in den acht Kapiteln vorgestellten Momente würden, auch wenn sie noch um einige Kapitel mehr ergänzt würden, keine lineare Erzählung bilden können, in der ein Element auf dem andern aufbaut. Es ist das große Verdienst dieses Buches, dass es gerade die Diskontinuitäten, die Brüche und inneren Widersprüche und nicht zuletzt die politischen Kontingenzen sorgfältig nachzeichnet, die die Entwicklung des Völkerstrafrechts kennzeichnen. Und dennoch, auch dies macht Lewis deutlich, bleiben die jeweiligen Bruchstücke im Gedächtnis, kommen als Referenzpunkte wieder zum Vorschein und verschwinden nicht aus der Geschichte. In diesem Sinn ein ungemein anregendes lesenswertes Werk.
Rainer Huhle