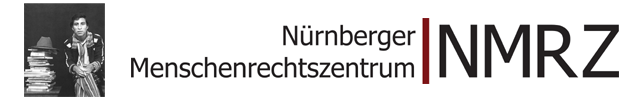von Heiner Bielefeldt, Otto Böhm und Rainer Huhle
Die wöchentlich von der Bundeszentrale für Politische Bildung publizierte Broschüre „Aus Politik und Zeitgeschichte“, die u.a. jeweils der Wochenzeitung „Das Parlament“ beiliegt, ist ein viel genutztes Instrument in der politischen Bildungsarbeit, da es kostenlos sowohl gedruckt als auch elektronisch zur Verfügung steht. So gehören die jeweils einem Thema gewidmeten Hefte, die normalerweise sechs Fachbeiträge enthalten, zu den einflussreichsten Medien der politischen Bildung. Das Thema „Menschenrechte“ kommt dabei in expliziter Form eher selten vor. Umso gespannter waren wir im Nürnberger Menschenrechtszentrum, wo wir Menschenrechtsbildung seit den frühen Neunziger Jahren betreiben, auf das Themenheft „Menschenrechte“ vom 11. Mai 2020.
In der vorliegenden Rezension konzentrieren wir uns auf lediglich drei von sechs Beiträgen, nämlich auf diejenigen Texte, die sich mit den Menschenrechten ganz grundlegend beschäftigen: Verfasst sind sie von Anne Peters zusammen mit Elif Askin, von Stephen Hopgood sowie von María do Mar Castro Varela zusammen mit Nikita Dhawan. Außerdem besteht das Heft aus drei thematisch enger gefassten Beiträgen, die jeweils einen Überblick über spezifische Themen der Menschenrechtspolitik geben: einen Rückblick auf „Drei Jahrzehnte Kinderrechtskonvention“, verfasst von Claudia Kittel, der Leiterin der Monitoring-Stelle zur Umsetzung dieser Konvention am Deutschen Institut für Menschenrechte; einen kurzen Beitrag über die 75 Jahre des UN-Menschenrechtsschutzsystems von Hannah Birkenkötter und Lise Heemann, der Generalsekretärin der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN); sowie einen Beitrag von Wolfgang Kaleck, dem Gründer und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) über neue Formen und Methoden internationaler Menschenrechtsnetzwerke von unten, nicht zuletzt die u.a. vom ECCHR mit unterschiedlichem Erfolg betriebenen Prozesse im Rahmen der „universellen Jurisdiktion“, also der Klage wegen international geächteter Menschenrechtsverstöße vor nationalen Gerichten.
Innerhalb der drei grundlegend gehaltenen Texte sind zwei aus „kritischer“ Perspektive formuliert. Geradezu schrill fällt das Verdikt des britischen Politologen Stephen Hopgood aus, wie schon der Titel seines Beitrags zeigt: „Morbide Symptome – Die Krise der Menschenrechte“. Bekannt geworden wurde Hopgood vor einigen Jahren mit einem ähnlich spektakulär klingenden Buchtitel „The Endtimes of Human Rights“, in dem er das internationale Menschenrechtsschutzsystem definitiv für gescheitert erklärt. Seine stets plakativen Thesen basieren dabei auf Prämissen, über die sich zumindest streiten ließe. So assoziiert Hopgood den historischen Durchbruch und Aufstieg der Menschenrechte aufs Engste mit der politischen Hegemonie des Westens, insbesondere der USA – als hätten Menschen außerhalb des Westens nicht ebenfalls zur Erarbeitung und Aktualisierung der Menschenrechtsidee beigetragen. Hopgoods Positionierungen sind typischerweise frei von Selbstzweifeln und lassen keinen Raum für Ambivalenzen. Dies gilt auch für den im APuZ-Heft abgedruckten Text. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass er keine einzige Fußnote enthält; für Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung ist dies ungewöhnlich. Völlig ohne Belege, weitgehend frei von Argumenten und ohne die geringste Bereitschaft, etwaigen Gegenevidenzen zur eigenen Positionierung Raum zu geben, diagnostiziert Hopgood einmal mehr den unmittelbar bevorstehenden Tod des Menschenrechtsprojekts, dem er offenbar keine Träne nachweint. Etwas Anderes als ein wirkungsloses Überbauphänomen eines ökologisch abgewirtschafteten kapitalistischen Systems vermag Hopgood in den Menschenrechten anscheinend nicht zu sehen. Abgesehen von überspitzter Semantik hat der Text nicht viel zu bieten. Dementsprechend lapidar fällt auch das Fazit aus: „Wir müssen abwarten, was folgt, wenn die morbiden Symptome abgeklungen sind: Vielleicht eine neue Reihe globaler Institutionen, vielleicht wird es aber auch gar keine Institutionen dieser Art geben.“ Damit endet der Text. Man fragt sich, welchen politischen Bildungsgewinn sich die Herausgeber*innen des Hefts von einem solchen Beitrag erhoffen.
Im Vergleich zu Hopgoods hoffnungsloser Morbiditätszuschreibung erweist sich die Kritik, die María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan aus postkolonialer Perspektive an den Menschenrechten zu Wort, als offener. Dem im Titel formulierten Postulat – „Die Universalität der Menschenrechte überdenken“ – kann man grundsätzlich nur zustimmen. In der Tat bleibt der universale Geltungsanspruch der Menschenrechte gleichsam stets auf „Bewährung“ und erfordert immer wieder neue kritische Reflexionen und Adaptierungen. Allerdings zeigt der Text generell wenig Vertrautheit mit der jüngeren Praxis des internationalen Menschenrechtsschutzes, wenn etwa – unter Verweis auf Foucault – der Menschenrechtsidee pauschal ein „inhärenter Anti-Etatismus“ zugeschrieben wird; dass in den letzten Jahrzehnten international gerade auch wirtschaftliche und soziale Menschenrechte eine deutliche internationale Aufwertung erlebt haben, bleibt außen vor. An anderer Stelle heißt es: „Immer wieder beruft sich der Globale Norden auf die Menschenrechte, um Staaten des Globalen Südens anzuprangern und in ihre internen Belange einzugreifen.“ Dass nach wie vor ein globales Nord-Süd-Machtgefälle besteht, wird niemand ernsthaft bestreiten können. Viele der Individualbeschwerden, die von den menschenrechtlichen Fachausschüssen der UN, darunter dem UN-Ausschuss zur Abschaffung rassistischer Diskriminierung, behandelt werden, richten sich jedoch gegen Staaten aus dem globalen Norden. Davon ist im Text genauso wenig die Rede wie vom Verfahren des „Universal Periodic Review“, das der UN-Menschenrechtsrat seit 2008 durchführt und dem sich sämtliche UN-Mitgliedsstaaten zu unterziehen haben. Natürlich können in einem kurzen Aufsatz nicht alle relevanten Entwicklungen aufgezeigt werden. Wenigstens die Weltkonferenz zum Thema Rassismus, die im Jahre 2001 in Durban – also im Südafrika der post-Apartheid-Ära – durchgeführt wurde, hätte aber Erwähnung verdient; denn im Abschlussdokument der Durban-Konferenz kommen viele der Themen ausführlich zu Wort, die Castro und Dhawan im Menschenrechtsdiskurs vermissen. Kein Wort findet sich auch zu den Rechten indigener Völker, obwohl gerade dazu in den letzten Jahren erhebliche Durchbrüche zu verzeichnen waren. Ausgesprochen praxisfremd geraten ausgerechnet die Ausführungen zum UN-Abkommen zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung der Frau. In diesem inzwischen von fast allen Staaten der Welt ratifizierten Abkommen, so behaupten die Autorinnen, seien „westliche Rechte per se als modern und emanzipatorisch“ bestimmt, „während die Quelle der Unterdrückung von Frauen in ehemals kolonisierten Ländern vor allem in den angeblich ‚traditionellen‘ kulturellen Praktiken gesucht wird“. Ein Beleg für diese weitreichende Behauptung findet sich nicht. Im Monitoring-Ausschuss, der die Implementierung des UN-Abkommens zur Frauendiskriminierung überwacht, sind jedenfalls seit Jahrzehnten Mitglieder (mehrheitlich Frauen) aus sämtlichen Weltregionen vertreten, und die Berichte des Ausschusses beschäftigen sich intensiv beispielsweise auch mit diskriminierenden Auswirkungen „westlicher“ Werbung oder impliziten Ausschlussmechanismen im Arbeitsmarkt europäischer Staaten. Die Pauschalität, mit der – offenbar ohne Vertrautheit mit der aktuellen internationalen Menschenrechtspraxis – holzschnittartige Zuschreibungen stattfinden, irritiert dann doch sehr. Die Ausführungen der beiden Autorinnen münden in das Postulat, „dass die gewalttätige Geschichte Europas, die im Erbe der Aufklärung widerhallt, reflektiert und herausgefordert wird“. Diesbezüglich steht zweifellos weitere Arbeit an.
Angesichts der Gesamtanalage des Heftes – mit drei thematisch enger gefassten Spezialbeiträgen und zwei kritischen Grundsatzbeiträgen – kommt dem einführenden Grundsatzaufsatz eine umso wichtigere Funktion zu. Er soll deshalb in der vorliegenden Rezension ausführlicher gewürdigt werden. Für diesen Beitrag zeichnen Anne Peters und Elif Askin verantwortlich, Direktorin bzw. wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Der Beitrag gibt einen knappen Überblick über den Normenbestand im globalen wie im regionalen Menschenrechtsschutz, diskutiert das Spannungsverhältnis zwischen universalem Geltungsanspruch und dem Pluralismus der Kulturen und identifiziert unter der Überschrift „Backlash“ aktuelle Gefährdungen. In konzeptioneller Hinsicht bleibt dabei manches unscharf, wenn nicht dunkel. Reichlich verschwommen klingt etwa der Satz: „Menschenrechte verwandeln damit Opfer in Bürger (empowerment).“ Unklar formuliert ist die Aussage, „Menschenrechtsschutz [sei] eine Sache der internationalen Gemeinschaft […] und keine innerstaatliche Angelegenheit.“ Hier besteht das Risiko von Missverständnissen, beruht doch das gesamte internationale Menschenrechtsschutzsystem darauf, dass die internationalen Normen innerstaatlich umgesetzt werden – vielleicht war das ja mit der Verwandlung des Opfers in den „Bürger“ gemeint. Wirklich klar wird dies im Text nicht.
Den Abschnitt über die Kodifikationen der Menschenrechte nach 1945 leiten die Autorinnen mit dem Verweis auf das bekannte Paradox vom Staat ein, der einerseits die Menschenrechte vielfach verletzt, andererseits aber auch die Institution ist, die diese Rechte schützen soll. An diesem Paradox haben sich schon viele Menschenrechtstheoretiker*innen den Kopf zerbrochen. Es ist in der Tat eine ständige Herausforderung, die auf die janusköpfige Rolle zumindest moderner Verfassungsstaaten verweist. Warum aber daraus folgen soll, wie die Autorinnen im nächsten Satz schreiben, dass in failed states oder bei prekärer Staatlichkeit die Menschenrechtslage schlechter als in stabilen Staaten sein soll, erschließt sich weder theoretisch, noch scheint es empirisch evident. Sind die Menschenrechte im stabilen China wirklich besser geschützt als z.B. im Kosovo oder in der West-Sahara?
Anschließend wenden sich Peters und Askin der Geschichte des institutionalisierten globalen Menschenrechtsschutzes seit der UN-Charta zu. Die Darstellung erfolgt nach dem eigentlich überwunden geglaubten Begriffsschema unterschiedlicher „Generationen“ von Menschenrechten, das nicht nur in systematischer Hinsicht zu Missverständnissen Anlass gibt, sondern auch historisch zu kurz greift. Gerade weil die Autorinnen durchaus darauf verweisen, dass sowohl die bürgerlich-politischen als auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK-)Rechte heute einklagbare Rechte sind, wäre es sinnvoll gewesen, auf den Generationenbegriff bei der Darstellung der Menschenrechtsentwicklung zu verzichten. Die Universelle Erklärung von 1948 stellt die WSK-Rechte auf die gleiche Ebene wie die politischen Freiheitsrechte, und gerade das Recht auf Leben, das in der Endfassung im Artikel 2 als „Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person“ formuliert ist, war in den über zweijährigen Vorarbeiten lange im Zusammenhang mit den Artikeln 22 – 25 diskutiert worden, die den Kernbestandteil der sozialen Rechte in der Erklärung bilden. Während in den Menschenrechtserklärungen, die im Kontext der antifeudalen Revolutionen in England, Frankreich und Amerika entstanden, die politischen Freiheitsrechte den Kern bilden (aber auch von zahlreichen sozialen Forderungskatalogen begleitet wurden, die es nicht in die Erklärungen schafften), waren es auf internationaler Ebene die wirtschaftlichen und sozialen Rechte, die als erste kodifiziert wurden.
Im nächsten Abschnitt wird das Spannungsverhältnis von „Universalität und Kulturelle Vielfalt“ angesprochen, in der Tat ein Feld, das die Debatten um die Menschenrechte seit der Erarbeitung der Universellen Erklärung intensiv befeuert (wie u.a. der Beitrag von Castro/Dhawan im Heft zeigt). Auf die theoretischen oder auch ideologischen Positionen in dieser reichhaltigen Diskussion, etwa auf das Stichwort „Asiatische Werte“ gehen Peters und Askin nicht ein, sondern beschränken sich angesichts des knappen Raums auf die z.B. von der UNESCO vorgeschlagene Formel, wie die beiden legitimen Ansprüche zueinander stehen. Sie kommen zu dem Schluss, dass dieses Verhältnis, auch vor den zuständigen Menschenrechtsinstitutionen, immer wieder neu auszuhandeln sei, weil auch die universellen Menschenrechte kulturell flexible Interpretationen zulassen könnten und müssten. Als Leitidee dafür bieten die Autorinnen den Begriff „‘milder‘ Relativismus“ an, der kulturellen Pluralismus Rücksicht nimmt, „ohne aber ein universelles Minimum zu unterschreiten“. Man würde gern wissen, worin dieses unverzichtbare Minimum besteht. In einer Fußnote verweisen die Autorinnen in diesem Zusammenhang auf einen empirischen Survey zur weltweiten Ermittlung von Wertvorstellungen. Dass die empirische Soziologie in normativen Fragen Orientierung geben kann, werden sie sicherlich nicht vertreten. Was ist aber dann mit diesem Hinweis gemeint? Wie vieles andere bleibt diese Frage ungeklärt. Schief gerät die Darstellung außerdem, wenn Verbrechen wie Ehrenmorde oder Genitalverstümmelung, die „von Behörden toleriert“ werden, als Ausdruck kulturell verschiedener Interpretation von Menschenrechten angeführt werden. Probleme fehlender Rechtsdurchsetzung werden hier vorschnell mit der Frage kulturell unterschiedlicher Rechtsinterpretationen vermengt. Staaten tun oder tolerieren überall Vieles, was Menschenrechte verletzt. Zu klären wäre deshalb in jedem konkreten Fall, ob sie ihre schlechte Praxis, also die mangelnde Durchsetzung von Menschenrechten, auch in ihrer Gesetzgebung oder anderen normativen Verfahren als zulässige Menschenrechtsinterpretation proklamieren. Genitalverstümmelung z.B. ist in den meisten Ländern, wo sie immer noch praktiziert und möglicherweise auch von den „Behörden toleriert“ wird, längst gesetzlich verboten. Gleiches gilt auch für die Ermordung von Frauen unter Berufung auf tatsächliche oder angebliche Ehrenkodexe, die auch in den Ländern, in denen sie Männer mit Berufung auf kulturelle Traditionen rechtfertigen, verboten sind.
Nach der Diskussion der Universalismusproblematik erklären die Autorinnen relativ ausführlich die internationalen und regionalen Mechanismen zur Durchsetzung von individuellen Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen. Daran schließen sie eine kurze Betrachtung über „Ausweitungen und Verfeinerungen“ der Menschenrechte an. Sie erwähnen die in Europa bereits teilweise anerkannte Geltung der Menschenrechte für das Handeln von Mitgliedstaaten außerhalb Europas und verweisen auf Grenzen der extraterritorialen Anwendung von Menschenrechtsnormen in komplexen Verantwortungsketten. Ebenso gehen sie auf die Debatte um die menschenrechtliche Verantwortlichkeit nicht-staatlicher Akteuren, insbesondere transnationaler Wirtschaftsunternehmen ein, sowie auf den derzeit in der UNO diskutierten Vertragsentwurf, der Staaten verpflichten soll, Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Themen werden bei aller Kürze verständlich angesprochen. Nur erwähnt wird hingegen, dass auch „neue Menschenrechte anerkannt“ und „neue Rechtsträger identifiziert“ werden, ohne dass man erführe, was damit gemeint ist. Insgesamt leistet diese Einführung in den Internationalen Menschenrechtsschutz leider nicht, was man an dieser Stelle erwarten darf. Zu Vieles ist missverständlich oder schief formuliert, Themen sind angerissen, ohne wenigstens in ihren Grundzügen oder auch ihrer Problematik ansatzweise entwickelt zu werden.
Für die Praxis der Menschenrechtsbildung sind am ehesten die drei konkreter gefassten Beiträge aus dem APuZ-Heft geeignet, die hier nicht besprochen worden sind. Wer in menschenrechtlichen Grundsatzfragen etwas lernen will, wird hingegen enttäuscht sein.