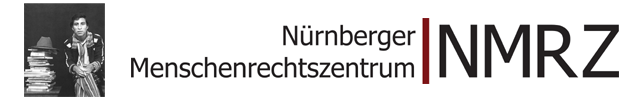von Otto Böhm
Die Allgemeinheit der Menschenrechte wird niemand für sich selbst oder für seine Gruppe ernsthaft in Zweifel ziehen wollen. Dennoch wird im politischen Konfliktfall der moralische und rechtliche Universalismus der Menschenrechte von Diktatoren (meist im Osten und „globalen Süden“) als westliche Einmischung zurückgewiesen. Deren mit dieser Zurückweisung verbundenes Herrschaftsinteresse ist leicht zu durchschauen. Ganz anders gelagert (und eine aktuelle Aufgabe für die politische Bildung) ist das verbreitete und vielschichtige Unbehagen am Universalismus der Menschenrechte hierzulande. Es hat eine breite Basis in der akademischen Welt (z. B. im cultural turn, in genealogischen, dekonstruktivistischen und konstruktivistischen Ansätzen) und speist sich aus den antirassistischen, postkolonialen und feministischen Bewegungen der westlichen Welt und des „globalen Südens“. Diese Diskurse haben in der Lesart der Autorin das Potential, mit ihrer Kritik die universalistische Idee der Menschenrechte zu schwächen, aber auch, richtig vermittelt, sie zu stärken. Gegenüber den ausschließlich negativen Kritiken an der Idee universeller Menschenrechte entwickelt Janne Mende im vorliegenden Buch einen produktiven Ansatz, sie nennt ihr Konzept „vermittelnder Universalismus“. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet vier Vorwürfe in ihren Plausibilitäten und ihren Grenzen – am Beispiel der jeweiligen theoretischen Protagonistinnen und Protagonisten – durch:
- „Menschenrechte sind westlich“ (die postkoloniale Kritik am westlichen Universalismus von Menschenrechten)
- „Es gibt keinen Universalismus“ (die kulturrelativistische Kritik am abstrakten Universalismus von Menschenrechten)
- „Menschenrechte bedrohen Kulturen“ (die kollektivrechtliche Kritik am individualistischen Universalismus).
- “Menschenrechte sind für Männer”: Die Allgemeingültigkeit des universalistischen Menschenrechtsverständnisses wird partikular, wo sie „FrauenMenschenrechte“ (J.M.) nicht versteht und vertritt. Mit Bezug auf die schon vielfach formulierte feministische Menschenrechtskritik vermisst die Autorin – und das ist eine zentrale gedankliche Achse des Buches – auch in den postkolonialen, kollektivrechtlichen oder kulturrelativistischen Strömungen die Reflexion auf die FrauenMenschenrechte.
Mende, die im Max-Planck-Institut für ausländisches und öffentliches Recht in Heidelberg eine Forschungsgruppe leitet, legt im Kern ein philosophisches Konzept der Vermittlung von Universalismus und Partikularismus vor und bedient sich dabei der Begrifflichkeiten von Hegel, Adorno, Taylor oder Muller-Okin. Sie entfaltet ihre Argumentation durchaus auch im Kontext ihrer eigenen eher ethnologisch orientierten Forschungsergebnisse zu den Rechten indigener Völker und zur Ambivalenz von Gruppenrechten sowie zur Praxis weiblicher Genitalexzision.
Die Autorin nimmt ihre eigenen Desiderate in punkto Selbstreflexion Ernst und erklärt die eigenen moralischen Grundlagen: Was sie schon zu Beginn klar sagt – dass ihrem Konzept drei normative Bezugspunkte zu Grunde liegen: die Menschenwürde, der Anspruch, Leiden zurückzudrängen so wie die Freiheit – das begründet sie im Schlusskapitel. Sie will jede naturrechtliche oder sonstige Letztbegründung und jeden Essentialismus vermeiden.
Hier sehe ich eine Inkonsequenz und möchte einen Einwand formulieren: Mende teilt mit vielen engagierten und reflektierenden Menschen die menschenrechtlichen Grundlagen Menschenwürde, Leidvermeidung und Freiheit. Trotzdem hält sie die inzwischen übliche Zurückweisung jedes Essentialismus und Fundamentalismus für nötig. Aber auch wenn die kritische Reflexion auf Fundamente nötig ist und die Menschenrechte nicht vom Himmel gefallen sind, sondern sich historisch aus den Erfahrungen der leidgeprüften Menschheit entwickelt haben: es macht wenig Sinn, sie immer weiter in antiessentialistischer Manier als kontingent und konstruiert zu entlarven, wenn doch offensichtlich ist, dass mit Leidvermeidung, Freiheit und Menschenwürde seit 2500 Jahren (seit der sogenannten Achsenzeit) sich Normen entwickelt haben, die durch die historische Einübung ihre Kontingenz verloren haben und fast schon als anthropologisch tiefsitzend bezeichnet werden können.
Das Buch ist methodisch klar strukturiert: Jedes Kapitel entfaltet –ausgehend vom universalistischen Grundverständnis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, von der Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 und dem etablierten Menschenrechtsregime – das Einerseits-Andrerseits, das Produktive und das Begrenzte der drei genannten Strömungen. Es erfüllt so den Anspruch der wissenschaftlichen Einführungen des utb-Verlages.
Das Buch ist eine empfehlenswerte Vorbereitung auf Seminare und Veranstaltungen zur Menschenrechtsbildung, zugleich eine sachhaltige Information über einzelne Themenfelder wie auch über den aktuellen Stand der landläufigen Einwände! Und eine klare Botschaft: Der Universalismus muss offener, pluraler, machtsensibler und reflexiver werden.