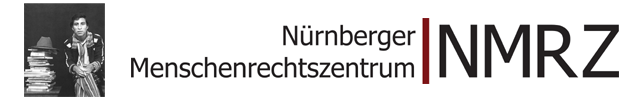Was eine historisch-politische Menschenrechtsbildung selbstkritisch überdenken sollte [1]
von Otto Böhm
„Die Universalität der Menschenrechte überdenken“ – dieser Aufforderung zur selbstkritischen Reflexion kommen seit einem Vierteljahrhundert viele Autorinnen und Autoren in der Menschenrechtsliteratur nach. Meist bleibt dabei im Ergebnis doch die normative Festlegung der Wiener UN-Menschenrechtskonferenz von 1993, dass die Menschenrechte universal, unveräußerlich und unteilbar sind, stehen.
„Die postkolonialen Studien haben den Missbrauch der Menschenrechtsrhetorik an zahllosen entlarvenden Beispielen der Kolonialmächte belegt. Aber es ist ein Kurzschluss, daraus per se zu schließen, dass die normative Geltung der Menschenrechte selber auf ihren okzidentalen Entstehungskontext beschränkt ist. Anders wären zum Beispiel die Fortschritte auf dem Wege des klassischen Völkerrechts zu einem universalistisch begründeten Recht der Völkergemeinschaft kaum zu erklären. Kurzum, die universalistische Auffassung von Moral und Recht kann nicht durch solche historischen Beispiele, sondern nur durch philosophische Argumente widerlegt werden – und die sehe ich bisher nicht.“ (Jürgen Habermas: Moralischer Universalismus in Zeiten politischer Regression Jürgen Habermas im Gespräch über die Gegenwart und sein Lebenswerk, in: Leviathan, 48. Jg., 1/2020, S. 7 – 28, S. 18.)
Und auch in vielen kurzen Einführungen der politischen Bildung wird das Vermittlungsthema ‚Menschenrechte‘ mit dem Grundgedanken eingeführt, dass ihr Spezifikum gerade darin besteht, dass sie für alle Menschen gelten (zum Beispiel Bernhard Stahl, Internationale Politik verstehen, Kapitel ‚Menschenrechte‘, Bonn 2016, S. 73–84; K. Peter Fritzsche/Peter G. Kirchschläger/Thomas Kirchschläger, Grundlagen der Menschenrechtsbildung, Kapitel ‚Normativität, Universalität, Diversität,‘ Schwalbach/Ts. 2017, S. 50 80). Der Schutz ihrer Rechte ist für unendlich viele Menschen existenziell wichtig.
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat in ihrer Zeitschrift APuZ 20/2020 mit dem Schwerpunkt „Menschenrechte“ [2] einen Aufsatz mit der oben zitierten Aufforderung publiziert. Der Artikel von María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan zeigt wenig Vertrautheit mit der jüngeren Praxis des internationalen Menschenrechtsschutzes oder der Arbeit des Deutschen Institutes für Menschenrechte. Ich lese den Artikel eher als eine grundsätzliche Kritik mit Zuspitzung auf die „ambivalente Rolle, die das Recht im (Post-)Kolonialismus eingenommen hat“ (S. 33).
Die beiden Autorinnen, Lehrstuhlinhaberinnen an Hochschulen in Deutschland, beziehen sich auf die Menschenrechtskritik, wie sie im englischsprachigen Raum schon seit einem Vierteljahrhundert ausgearbeitet wird. Es ist eine Sicht des „Globalen Südens“, die Castro Varela/Dhawan vertreten und die sie feministisch und marxistisch erweitern [3]. Ihre Bezugsautorinnen und -autoren, auf deren Arbeiten sie sich in ihrem APuZ-Text stützen, sind dabei:
- Makau Mutua, aus Kenia stammender Professor an der Buffalo Law School,
- Gayatri Shakravorty Spivak, aus Indien stammende Literaturwissenschaftlerin, die an der Columbia University in New York lehrt,
- Antony Anghie, aus Australien stammender Völkerrechtler an der National University of Singapore.
Für ihren Beitrag formulieren die beiden Autorinnen das postkoloniale Paradigma so:
„Da die postkoloniale Theorie auf die Offenlegung epistemischer und diskursiver Gewalt eurozentrischer Normen fokussiert, wird die Frage der Dekolonisierung immer in ihrem Verhältnis zu Themen wie transnationaler Gerechtigkeit, Demokratisierung, Menschenrechten, Globalisierung, Entwicklungspolitiken und dem schwierigen Erbe der europäischen Aufklärung untersucht. So werden die komplexen kolonialen Genealogien gegenwärtiger Diskurse, Institutionen und Praktiken bearbeitet und die Implikationen des Kolonialismus für die Verfasstheit gegenwärtiger globaler Politiken analysiert. Insbesondere die ambivalente Rolle, die das Recht im (Post-)Kolonialismus eingenommen hat, wird kritisch beleuchtet. Dies schließt eine genauere Auseinandersetzung mit den zumeist a priori als positiv beschriebenen internationalen Menschenrechten ein.“ (S .33).
Die Grundstruktur dieser Menschenrechtskritik lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Indem Menschenrechte in ihrer Substanz “vom Westen“ als zivilisiertere Entwicklungsstufe der Völker und Staaten propagiert werden, diese also noch auf das höhere Niveau kommen müssten, sind die Menschenrechte gerade durch diese Unterscheidung Teil des neokolonialen Macht-Wissens, das der Postkolonialismus [4] insgesamt wissenschaftlich zurückweist und politisch bekämpft.
In dem kurzen und plakativen APuZ-Text [5] werden neben den Frauenrechten drei weitere Bereiche kritisch betrachtet: der Universalismus-Anspruch, der „Rechte-Diskurs“ und der „Helfen-Diskurs“. Für die Menschenrechtsbildung, wie wir sie seit Jahren begründen und gestalten [6], sind dies drei zentrale Bereiche, mit denen ich mich hier auseinandersetzen will. Meine Grundgedanken, das sei vorneweg gesagt, sind dabei:
- Allgemeingültigkeit ist tatsächlich ‚unverhandelbar‘ im Sinne der Würde jedes einzelnen Menschen;
- Recht bedeutet nicht zwingend auch Gerechtigkeit, aber ‘das Recht, Rechte zu haben’, gehört zum politischen Grundverständnis jeder Menschenrechtsarbeit;
- ‚Helfen‘ als weltweite advokatorische und anklagende Praxis von Menschenrechtsorganisationen hat naturgemäß unterschiedliche Ausgangspunkte, gehört aber in der ,einen Welt’ zur solidarischen Praxis von zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Castro Varela/Dhawan wollen die „postkoloniale Menschenrechtskritik“ vorstellen und eine eigene feministisch-postkoloniale Lesart empfehlen. Ein spezifischer politischer Handlungsansatz wird bei ihnen und ihrem durchgängig nur pauschal eingesetzten Begriff „die Menschenrechte“ und „die Menschenrechtsbewegung“ nicht deutlich [7]. Am Ende geht es nur um eine pauschale Universalismus-, Rechts- und NGO-Kritik, die je nach Standort oder wissenschaftlichem Ansatz Beifall oder Abwinken hervorrufen wird. Ich will deshalb ergänzend einen kurzen, menschenrechtsbezogenen Durchgang durch den Band „Einführung in die postkoloniale Theorie“ [8] der beiden Autorinnen machen, um die postkoloniale Lesart kritisch nachzuvollziehen.
Universalismus
Was ist das Argument oder der Vorwurf gegen den menschenrechtlichen Universalismus (‚unveräußerlich, unteilbar und universal gültig‘)?
- Die postkoloniale Menschenrechtskritik beginnt mit einem Blick auf die Weltkarte und die Markierung gerade des „globalen Südens“ als Region der Menschenrechtsverbrechen. Diese politisch-moralische Kartographie sei bezeichnend für den westlichen Blick. Aber stimmt das auch noch in Erinnerung an den Völkermord in Jugoslawien, hinter dem die Wahrnehmung Ruandas ‚verblasste‘? Und stimmt das auch noch angesichts der umfassenden Menschenrechtskritik an China? Ist China möglicherweise gar nicht in das Schema des Postkolonialismus einzuordnen? Zudem kann in der postkolonialen Menschenrechtskritik die Sprengkraft der Bürgerrechte gegenüber kommunistischen Diktaturen nicht verstanden werden.
- Menschenrechte seien eine Norm, die als Kriterium für Ausschluss/Zugehörigkeit zur Welt der demokratischen und liberalen Staaten eingesetzt wird. Es ist unwiderlegbar, dass sie ein selektiv eingesetztes machtpolitisches Instrument sein können. Aber umgekehrt wird nicht behauptet werden können, dass das ihre einzige Funktion ist. Gerade ihre allgemein anerkannte normative Substanz ermöglicht ihren Missbrauch.
- Menschen in den Kolonien seien gegenüber der Erklärung 1948 äußerst skeptisch gewesen, weil die grausamsten Verbrechen gegen ihre Völker gerade von den Kolonialherren ausgingen. Mit Recht wird diese Perspektive betont; sie traf jedoch damals nicht auf die Vertreter der USA, Pakistans, Indiens, Chinas oder Lateinamerikas in der entstehenden UNO zu. Die formulierten bürgerlich-politischen und wirtschaftlich-sozial-kulturellen Rechte wurden zudem nicht wegen ihrer Inhalte, sondern wegen ihrer mangelnden Realisierung kritisiert. Aus diesem Widerspruch bezog der Kampf gegen den Kolonialismus immer wieder erfolgreich Munition. Die Menschenrechte wurden dabei nicht abgelehnt, sondern gegen die Kolonialmächte gewendet. Wie stark der politische Einsatz „des Westens“ dabei war und ob dann Staaten, die sich als NATO zusammengefasst haben, als ‚Böcke im Garten der Menschenrechte‘ betätigten, wurde und wird immer diskutiert, von Guatemala über Algerien, Vietnam, Chile und Nordirland.
Recht/Gerechtigkeit
Die postkoloniale Menschenrechtskritik verwirft das „westliche“ Rechtsdenken wegen seiner tragenden Rolle als Element der kolonialen Ausbeutung [9]. „Spivak konstatiert, dass Menschenrechtspolitik fast ausschließlich den globalen Süden ins Visier nimmt, was unweigerlich zu einer Einteilung der Welt in zwei Räume führt: die, von denen die Rechte zu kommen scheinen (globaler Norden), und jenen, in denen scheinbar keine vergleichbaren Rechte institutionalisiert sind (globaler Süden).“ (Castro Varela/Dhawan 2015, S. 207). Damit verfehle Recht seine Aufgabe, Gerechtigkeit herzustellen. Wieder wird mit Bezug auf Spivak wegen ihres Entstehungszusammenhanges die ganze ‚Sozialform Recht‘ verworfen oder zumindest unter Generalverdacht gestellt.
Dagegen ist daran zu erinnern, dass gesetzesbasierte Staatsformen nicht im „Westen“ entstanden sind, wie schon ein Blick in die übliche Erzählung der Geschichte der Menschenrechte zeigt (Bibel: Buch der Richter; Codex Hammurabi).
Wenn man/frau mit den Autorinnen davon ausgeht, dass sich in der Durchsetzung des Kolonialismus und Imperialismus Willkür und rechtliche Formen vermischten und ergänzten, wird m. E. die Selbstbehauptung gerade auch auf der rechtlichen Ebene stattfinden müssen. Pointiert gesagt: spätestens mit der Eroberung durch die Kolonialmächte waren die Menschenrechte unentbehrlich für die Völker geworden. Tatsächlich haben sich ja ausnahmslos alle postkolonialen Staaten und Regierungen des westlichen Staatsmodells in der einen oder andern Variante und natürlich auch des Völkerrechts bedient. Erst die Dekolonialisierung hat das Völkerrecht überhaupt universell gemacht.
Zwei Beispiele für den m. E. problematischen Umgang mit den international gesetzten völker- und menschenrechtlichen Standards im postkolonialen Denken: die Autorinnen schreiben: „Obschon sich nationale Befreiungsbewegungen durchaus auf das Völkerrecht beriefen, um ihr Selbstbestimmungsrecht einzufordern, blieben die institutionalisierten Hierarchien im internationalen Recht weiterhin erhalten und trugen zur Unterordnung vormals kolonisierter Länder bei.“ (Castro Varela/Dhawan 2015, S. 36). Die Hierarchien entstanden jedoch gerade trotz und jenseits der formalen, also institutionalisierten Gleichheit. Die Kolonialmächte verloren in den sechziger Jahren die Mehrheit in der UNO. Einrichtungen wie die UNCTAD entstanden, die eine entwicklungspolitische Agenda gegen imperiale Interessen durchzusetzen versuchten. Und das Menschenrechtsschutz-System der Vereinten Nationen entwickelte sich in der Spannung von ungleich starken, aber formal gleichen Staaten in Auseinandersetzung mit den Anstrengungen der Menschenrechtsbewegungen.
Helfer/Solidarität
Die postkolonialen Kritikerinnen stellen sich scheinbar vorbehaltlos auf die Seite der Staaten des Südens und gegen die Kritik an deren Menschenrechtsverletzungen und die Arbeit der Menschenrechts-NGOs:
„Denn die Menschenrechtsagenda trägt dazu bei, die institutionelle Macht internationaler Organisationen zu vermehren, und dient immer wieder, oft unter dem Vorwand der Schutzverantwortung, als Alibi für strategische und/oder militärische Interventionen.“ (Castro Varela/Dhawan 2015, S. 210). Sie nehmen die teilweise berechtigte und unwiderlegbare Kritik für die ganze Wirklichkeit. Soll wirklich die gesamte „Menschenrechtsagenda“ mit dem historischen Argument der Kolonial-Verbrechen oder mit dem aktuellen Argument des Menschenrechtsinterventionismus in Misskredit gebracht werden? Zwingt die belgische Grausamkeit und Ausbeutung im Congo heute die „westlichen Menschenrechtsgruppen“ zu Schweigen und politischer Enthaltsamkeit gegenüber den dortigen Bürgerkriegen? Ist die Unterdrückung gewerkschaftlicher Kämpfe nicht ebenso oft Folge ganz eigenständiger Herrschaftsinteressen und nicht die Folge westlichen Druckes?
Zudem: Alle diese Themen werden bearbeitet und sind ein selbstkritischer und an die Adresse des eigenen Staates gerichteter Hebel der menschenrechtlichen Solidaritätsarbeit z.B. mit den Gewerkschaften in Bangladesch.
Ausblick auf die politische Bildung
Unter dem Strich und als kritische Mahnung für die Menschenrechtsbildung und politische Praxis bleibt, was Castro Varela/Dhawan so zusammenfassen:
„In Verteidigung (westlicher) Menschenrechtspolitiken könnte sicher angeführt werden, dass ihr Anliegen darin bestehe, die Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen anzustreben. Allerdings scheint eben das zweifelhaft. Eine feministisch-postkoloniale Lesart aktueller Menschenrechtspolitiken ermöglicht hier die erforderliche Problematisierung unkritischer Solidaritätsgebaren sowie eurozentrischer und androzentrischer Diskurse zu globaler Gerechtigkeit: Die ‚Politik des Helfens‘ verdeckt ökonomische und geopolitische Interessen, während die hegemonialen Menschenrechtsdiskurse dem Globalen Norden als Rechtfertigung dienen, um im Globalen Süden einzugreifen.“ (APuZ, S. 35). Nur sollte eben das Kind ‚Menschenrechte‘ nicht mit dem Bad der Kritik ausgeschüttet oder verächtlich gemacht werden.
Es gibt in Deutschland einen Arbeitszusammenhang in der rassismus-kritischen Menschenrechtsbildung, in dem diese Sichtweise furchtbar wird und die z.B. von Astrid Messerschmidt schon seit 15 Jahren vertreten wird (Astrid Messerschmidt: Postkoloniale Erinnerungsprozesse in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft – vom Umgang mit Rassismus und Antisemitismus, in: Peripherie Nr. 109/110, 28. Jg. 2008, Münster, S. 42-60). Messerschmidt entwickelt für die politische Bildung „Ansatzpunkte für eine postkoloniale Aufarbeitung im spezifischen zeitgeschichtlichen Kontext der Bundesrepublik“ (S. 42). „Nach Auschwitz“ müsse das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus besonders sorgfältig vermittelt werden; das eine dürfe begrifflich nicht im anderen aufgehen. Der Völkermord in Namibia sei nicht einfach die Vorgeschichte der NS-Verbrechen. Und deren Monstrosität sollte nicht den gegenwärtigen Alltagsrassismus als vernachlässigbar erscheinen lassen. Diese „doppelte Perspektive“ wurde von Messerschmidt so formuliert:
„Ich möchte zugleich von einer postnationalsozialistischen und von einer postkolonialen Erinnerungsarbeit sprechen – einer Arbeit, die das, was sie reflektiert nicht loswird. Wenn ich heute versuche, eine Aufarbeitung des Kolonialismus anzustoßen, dann tue ich das in einer Gesellschaft, in der der Nationalsozialismus nachwirkt. Für die Erinnerungspädagogik ist diese kontextuelle Einbindung zentral. Auf der Ebene der historischen Erforschung von Kolonialismus und Holocaust ergeben sich die Zusammenhänge insbesondere durch eine vergleichende Genozidforschung, die Ähnlichkeiten und Unterschiede heraus arbeitet, Zusammenhänge und Diskontinuitäten rekonstruiert.“ (S. 56 f.).
Mein Fazit: Die kritische Auseinandersetzung mit dem hier vorgestellten Theorieansatz der postkolonialen Kritik lohnt sich. Allerdings wäre ein Text mit differenziertem und aktuellem Bezug zu Menschenrechten und Menschenrechtsbildung nützlicher gewesen.
[1] Anmerkungen zum Beitrag „Die Universalität der Menschenrechte überdenken“ von Maria do Mar Castro Varela/Nikita Dhawan, in: Aus Politik und Zeitgeschichte – Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung 20/2020, Seite 33–38.
[2] Siehe dazu auch die Kritik (Bielefeldt/Böhm/Huhle): https://www.menschenrechte.org/de/2020/06/13/eine-verpasste-chance-menschenrechte-aus-politik-und-zeitgeschichte-70-jahrgang-20-2020-11-mai-2020/
[3] Castro Varela und Dhawan arbeiten seit Jahren in diesem Feld (siehe: María do Mar Castro Varela/Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, Bielefeld 2020.) Castro Varela und Dhawan haben die „post-colonial studies“ in Deutschland vor allem auch im politisch-pädagogischen Zusammenhang vertreten. Castro Varela bezieht sich dabei besonders auf die Spivak‘sche Idee einer postkolonialen Pädagogik, die das hegemoniale Weltsystem und seine westlichen, weißen und männlichen Normen in Frage stellt.
[4] Die interdisziplinären „postcolonial studies“ haben als Denkweise/Diskurs/Ideologie den Postkolonialismus hervorgebracht. Der Gegenstand der Kritik ist also das Fortdauern der kolonialen und neokolonialen Herrschafts-Strukturen und Wissensformen.
[5] Dem mag auch manche Verkürzung geschuldet sein: Dem politischen Kampf, nicht aber der politischen Bildung angemessen ist, dass durchgehend vom „Westen“ als dem „Globalen Norden“ die Rede ist, dem der „Globale Süden“ gegenübersteht,. M.E. inakzeptabel sind aber Thesen wie „Der der Idee der Menschenrechte inhärente Anti-Etatismus ignoriert ausdrücklich, dass es für entrechtete Gruppen weiterhin darum geht, soziale Kämpfe innerhalb der Territorialität ihres Staates zu gewinnen.“ (S. 36) Diese Aussage ist falsch. Denn aus dem Menschenrechtschutz-System der Vereinten Nationen leiten sich ausdrücklich und primär Staatenpflichten ab.
[6] Vereinfacht gesagt, arbeiten wir uns in unseren Seminaren ab an den Spannungen zwischen der Zerstörung von Menschenwürde und Menschenrechten und der Gültigkeit der Rechte ohne Diskriminierungen. Die Rechte des Einzelnen sehen wir am ehesten durch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gesichert. Dabei bewegen wir uns eher im Antagonismus von NS-Diktatur und ihren Gegnern und Opfern als im Schema Nord-Süd oder zivilisiert-unzivilisiert oder entwickelt-unentwickelt. Und gerade weil man den Nationalsozialismus als Teil der westlichen Moderne beschreiben muss, gehört auch der Widerstand gegen ihn dazu.
[7] Ich nehme an, dass die Autorinnen mit einer Definition arbeiten, wie sie Makau Mutua zugrunde legt: „The ‘human rights movement’ refers to that collection of norms, processes, and institutions that traces its immediate ancestry to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the United Nations in 1948 as the textual foundation of the human rights movement and has been referred to as the ‘spiritual parent’ of most other human rights documents. (Makau Mutua: Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights, Harvard International Law Journal I Vol. 42 Number 1, Winter 2001, S. 201, Fussnote 1).
[8] María do Mar Castro Varela/Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, Bielefeld 2015, 2., komplett überarbeitete Auflage.
[9] Siehe auch im APuZ-Text S. 34: „Die Wirkmächtigkeit dieses Menschenrechtsdiskurses wird erst verständlich, wenn Recht und Rechtssetzungen als erforderliche Instrumente des Kolonialismus betrachtet werden, die sowohl in den kolonisierten Ländern als auch in Europa grundlegende Veränderungen im Verständnis von Gerechtigkeit hervorbrachten. Nicht selten haben Rechtsinstitutionen imperialistische Unternehmungen wortwörtlich legitimiert.“ Und weiter: „Ohne das Instrument des internationalen Rechts und dessen Konzeption von Privateigentum und Besitz sowie der Legitimierung von Konfiszierung und dem Aufzwingen von Regierungsformen wäre die Enteignung außereuropäischer Völker nicht in einer so systematischen Art und Weise möglich gewesen.“ (ebda., S. 35/36).