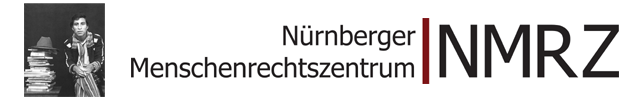von Erik Böhm
Die „Triage-Entscheidung“ (BVerfG, Beschl. vom 16.12.21 – 1 BvR 1541/20 -, Rn. 1-131, http://www.bverfg.de/e/rs20211216_1bvr154120.html, i.F. Bezugnahme auf Rn.), die das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2021 gefällt hat, hat medial nicht unerheblich für Aufsehen gesorgt. Insgesamt wurde die Entscheidung sehr positiv aufgenommen. Sie ist auch ohne Frage insoweit ausdrücklich zu begrüßen, als aus ihr unmissverständlich hervorgeht, dass eine Behinderung als solche nie ein Kriterium für die Entscheidung „gegen“ die Behandlung einer Patientin oder eines Patienten in Situationen mit beschränkten medizinischen Ressourcen sein kann. Im Folgenden soll nun jedoch etwas detaillierter betrachtet werden, was genau das Gericht entschieden hat, worin genau es ein Risiko der Benachteiligung wegen einer Behinderung in einer Triage-Situation gesehen hat und wie sich die Entscheidung in die grundrechtliche Schutzpflichtenkonzeption einfügt.
1. Was das Gericht entschieden hat (und was nicht)
Zunächst soll dargestellt werden, worin das Gericht konkret einen verfassungswidrigen Zustand gesehen hat und welchen Rahmen es dem Gesetzgeber zur Regelung der Triage hat. Das Gericht versteht in diesem Zusammenhang unter Triage die „Entscheidung über die Verteilung pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichtiger Ressourcen in der Intensivmedizin und damit (…) [eine] Entscheidung über Leben und Tod“ (Rn. 110). Den verfassungswidrigen Zustand sieht das Gericht darin, dass der Gesetzgeber untätig geblieben ist, „wirksame Vorkehrungen zu treffen, dass niemand […] aufgrund einer Behinderung benachteiligt wird“ (Rn. 87), obwohl sich der Schutzauftrag, der sich aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG ergibt, aufgrund des „Risiko[s] der Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Zuteilung knapper, überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen“ (Leitsätze) zu einer konkreten Schutzpflicht verdichtet hat (vgl. Rn. 108). Man kann dies auch einfacher ausdrücken: Menschen mit Behinderung müssen gesetzlich geschützt werden, weil sie konkret Gefahr laufen, bei der Triage diskriminiert zu werden. Worin genau dieses Risiko der Benachteiligung bestehen soll, wird gesondert unter (II.) behandelt.
Um diesen Schutz zu gewährleisten, trifft den Gesetzgeber die „Pflicht […], hiergegen wirksame Vorkehrungen“ (Rn. 109) „für die Verteilungsentscheidung über knappe intensivmedizinische Ressourcen“ (Rn. 122) zu treffen. Der Gesetzgeber hat mehrere Möglichkeiten, diese Pflicht zu erfüllen (Rn. 126 ff.). Leitende Prärogative sollte hierbei aber sein, dass auch die Behandlung von Nicht-Covid-Patienten sichergestellt wird, die „gebotene Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen“ berücksichtigt wird und die Letztverantwortung bei medizinischem Personal liegt (Rn. 127). Der Gesetzgeber kann entscheiden, ob er (verfassungskonforme) Entscheidungskriterien für eine Triage-Situation aufstellt und ob er das Entscheidungsverfahren (Mehraugenprinzip, Dokumentation oder auch Weiterbildungsangebote für medizinisches Personal) regelt (Rn. 128). Für zumindest eine der Optionen muss er sich logischerweise entscheiden; implizit lässt sich aus den Ausführungen des Gerichts jedoch ableiten, dass er bereits der Pflicht genügen würde, wenn er nur das Verfahren einheitlich regelt.
Auf die verfassungskonformen Entscheidungskriterien für eine Triage-Situation geht das Gericht ebenfalls ein. Es stellt zunächst grundsätzlich fest, dass das verfassungsrechtliche Verbot der „Abwägung von Leben gegen Leben“ (bekannt aus BVerfGE 115, 118, „Luftsicherheitsgesetz“ aus dem Jahr 2005) in Bezug auf die Triage keine Anwendung finde (Rn. 128); leider führt das Gericht hierfür keine Begründung an. Aus der gesamten Entscheidung ergibt sich darüber hinaus, dass nicht unmittelbar an das Kriterium der Behinderung angeknüpft werden darf; dies lässt sich wohl ohne Weiteres auch auf die anderen von Art. 3 GG umfassten Kategorien (konkret relevant wäre hierfür vor allem das Alter, das Geschlecht und die Herkunft) übertragen. An die klinischen Erfolgsaussichten „im Sinne des Überlebens der aktuellen Erkrankung“ (Rn. 118) im Unterschied zur „generellen“ Gebrechlichkeit oder zu Komorbiditäten anzuknüpfen ist jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich. Der Einsatz von medizinischen Skalen bzw. Punktesystemen (Scores) sei hierbei „nicht von vornherein unzulässig“, berge aber wiederum die Gefahr Diskriminierungen zu begünstigen (Rn. 118).
2. Risiko der Benachteiligung wegen einer Behinderung in einer Triage-Situation
2.1. Argumentation des Gerichts
Im Folgenden soll betrachtet werden, worin das Gericht das Risiko der Benachteiligung wegen einer Behinderung in einer Triage-Situation gesehen hat. Das Gericht führt unter Berufung auf Facheinrichtungen und Sozialverbände an, dass seitens der Entscheidungsträger „subjektive Momente“ (Rn. 111 f.) zu Benachteiligungen aufgrund einer Behinderung führen könnten. Aufgrund struktureller Defizite in den relevanten Ausbildungsberufen, fehle es an einem ganzheitlichen Verständnis von Behinderung und der Blick auf Behinderung sei stereotypisiert und defizitorientiert (vgl. Rn. 113). Die fachliche Empfehlung der DIVI (Deutsche interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) genüge nicht, dieses Risiko der Benachteiligung auszuräumen; zunächst, weil sie als S1-Leitlinie (wie alle medizinischen Leitlinien) nicht rechtlich verbindlich sei (Rn. 115); eine S1-Leitlinie ist eine lediglich informell von einem Expertengremium verabschiedete Handlungsempfehlung mit der (im Unterschied zu S2- und S3-Leitlinien) niedrigsten methodischen Qualität. Außerdem würde die DIVI-Empfehlung auch das Risiko bergen, dass die in ihr genannten Kriterien Komorbiditäten und Gebrechlichkeit, die laut der Empfehlung für eine schlechte Erfolgsaussicht intensivmedizinischer Maßnahmen sprächen, zu einer pauschalisierten und stereotypisierten Entscheidungsfindung insbesondere auch gegenüber Menschen mit Behinderung führen könnten (Rn. 118). Auch die zweifache Klarstellung seitens der DIVI, dass dies gerade nicht durch die Empfehlung bezweckt sei, sondern die genannten Kriterien nur Indikatoren für die aktuellen Überlebenschancen der aktuellen Erkrankung darstellten, würde dieses Risiko nicht ausräumen, nicht zuletzt aufgrund von raschen, von Unsicherheit geprägten Entscheidungsprozessen im klinischen Alltag mit beengten Kapazitäten (Rn. 119 f.).
2.2. Würdigung
Die Ausführungen dazu, dass die Gefahr der Benachteiligung aufgrund struktureller Fehlvorstellungen über Behinderung besteht, sind nachvollziehbar. Wenn auch Medizinerinnen und Mediziner vermutlich aufgrund ihrer klinischen Tätigkeit mehr Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben als weite Teile der Durchschnittsbevölkerung, so findet diese Begegnung vor allem unter klinischen Gesichtspunkten statt; hinzu tritt die der Natur der Sache entsprechende klinisch-krankheitsorientierte Ausbildung, die aber mit den Fächern „Medizinische Psychologie und Soziologie“ und „Ethik der Medizin“ durchaus versucht, auch hierüber hinausgehende Akzente zu setzen. Eine letztliche Bewertung zu diesem Aspekt steht mir jedoch nicht zu; die Erläuterungen der Facheinrichtungen und Sozialverbände stehen in dieser Hinsicht für sich und sollten auch über diese Entscheidung hinaus an den zuständigen Stellen Beachtung finden.
Weniger nachvollziehbar erscheinen mir hingegen die Ausführungen zu der DIVI-Empfehlung. Diese stellt ausdrücklich auf das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht ab, was das Gericht auch ausdrücklich billigt. Dem Kriterienkatalog der Empfehlung (3.2.1), auf den das Gericht Bezug nimmt, soll, wie von der DIVI ausgeführt und ausdrücklich in der Empfehlung dargestellt wird, lediglich Indikatorwirkung zukommen. Entgegen der Interpretation des Gerichts, das darin die Gefahr der Schematisierung und Benachteiligung sieht, ermöglicht der Katalog gerade eine evidenzbasierte, objektiv nachvollziehbare Entscheidungsfindung. Denn wenn man sich an der klinischen Erfolgsaussicht orientiert, müssen hierhingehend auch Vorerkrankungen und Behinderungen (bspw. des Atemsystems), die diese konkret beeinträchtigen, Berücksichtigung finden. Nichts anderes sagt auch das Bundesverfassungsgericht selbst aus; es bewertet die schematische Verwendung von Behinderung als Kriterium als unzulässig, die konkrete und einzelfallabhängige Einordnung einer Behinderung als Kriterium für die klinischen Überlebenschancen billigt es jedoch zumindest implizit (vgl. Rn. 118). Meines Erachtens ist es Medizinern durchaus zuzutrauen, mit einem solchen Katalog in diesem Sinne zu arbeiten; dieses Vertrauen fehlt dem Gericht in seinen Ausführungen jedoch augenscheinlich. Es verkennt, dass Medizinerinnen und Mediziner, insbesondere Fachärztinnen und Fachärzte für Anästhesiologie, deren Ausbildung neben der Intensivmedizin auch die Notfallmedizin und die (palliative) Schmerztherapie umfasst, mit zumindest funktionell vergleichbaren Abwägungs- und Verteilungsfragen konfrontiert sind. Die gesamte medizinische Ausbildung, wenngleich sie an vielen Stellen verbesserungswürdig erscheint, sowie der medizinische Berufsalltag sind ohne Frage lebensbejahend orientiert; die Entscheidung „für“ oder „gegen“ ein Leben steht hierzu prima facie in diametralem Widerspruch, sodass eine leichtfertige oder schematische Entscheidung von Medizinerinnen und Medizinern aus meiner Sicht schwerlich zu erwarten ist. Die Vorstellung, dass eine rechtlich verbindliche Regelung aus sich heraus anders ausfallende Entscheidungen zur Folge haben würde, verkennt dies.
Nicht zuletzt bleibt aus meiner Sicht unklar, inwieweit die Verpflichtung des Gesetzgebers zur gesetzlichen Regelung der Triage die strukturellen Probleme der Fehlwahrnehmung von Behinderung und der Kapazitätsengpässen im klinischen Alltag lösen soll. Zwar führt das Gericht Weiterbildungsangebote als potenzielle gesetzliche Mittel an. Ob diese zur Überwindung der strukturellen Fehlwahrnehmung genügen, ist aus meiner Sicht fraglich. Die Einführung weitergehender Vorschriften zum Verfahren (wie etwa eine zusätzliche Dokumentationspflicht) birgt außerdem die Gefahr, die in einem Triage-Szenario stark belasteten Medizinerinnen und Mediziner vermehrt zu belasten. Zuletzt erscheint es tendenziell widersprüchlich, den inhaltlichen Entscheidungskatalog der DIVI-Empfehlung als unzureichend einzuordnen, dem Gesetzgeber aber zugleich freizustellen, nur das Verfahren zu regeln.
3. Einordnung der Entscheidung in die grundrechtliche Schutzpflichtenkonzeption
Dass das Gericht die verfassungswidrige Verletzung einer Schutzpflicht bejaht hat, ist im Ergebnis meines Erachtens nicht übermäßig überraschend. Die Entscheidung ist ersichtlich derjenigen zur Zwangsbehandlung (BVerfGE 142, 313) nachempfunden und greift die allgemeinen Grundsätze der grundrechtlichen Schutzpflichtenkonzeption auf.
Im Rahmen der Schutzpflichtendogmatik ist zwischen dem Bestehen eines Anspruchs auf Schutz durch den Staat („ob“) und der Ausgestaltung dieses Anspruchs („wie“) zu unterscheiden. Beides muss sich aus dem Grundgesetz ergeben. Wo dieses hingegen keine konkreten Vorgaben macht, können die staatlichen Organe frei gestaltend tätig werden.
Das Gericht legt zunächst dar, dass Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG im Wege der Auslegung grundsätzlich „nur“ ein abstrakter, staatlich frei gestaltbarer Schutzauftrag zu entnehmen ist (Fn 89 ff., 97). Die Argumentationsleistung des Gerichts besteht also im Folgenden nun darin zu zeigen, dass dieser abstrakte Schutzauftrag sich vor dem Hintergrund der Pandemiesituation zu einer konkreten Schutzpflicht verdichtet hat („ob“ des Anspruchs auf staatlichen Schutz). Eine solche Verdichtung kann dann angenommen werden, wenn die Benachteiligung mit einer nicht durch die Betroffenen selbst abwendbaren Gefährdung für „hochrangige, grundrechtlich geschützte Rechtsgüter einhergeh[t]“ (Rn. 97), wie etwa dem Recht auf Leben. Dies deckt sich auch mit der Systematik bzgl. der Schutzpflichten in Bezug auf das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG); auch hier ist eine ausreichend konkrete Gefährdung für das Bestehen eines Schutzanspruchs gegenüber dem Staat notwendig (Dürig/Herzog/Scholz/Di Fabio, 2021, GG, Art. 2 Abs. 2 Nr. 1, Rn. 49 f.). Die Annahme einer Verdichtung hin zu einer solchen Schutzpflicht in diesem Fall wird darüber hinaus durch die gem. Art. 1 Abs. 2 GG zu berücksichtigenden völkerrechtlichen Verträge, insbesondere die UN-Behindertenrechtskonvention, gestützt, aus der sich ergibt, dass selbst in Naturkatastrophen, wie sie die Pandemie aus Sicht des Gerichts eine darstellt, der diskriminierungsfreie Zugang zu medizinischer Versorgung gewährleistet werden muss (vgl. Art. 11, 25 BRK sowie Fn 88, 102 ff.).
Für die Verdichtung des Schutzauftrags zu einer konkreten Schutzpflicht müsste also das Risiko der Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Triage bestehen; es müssen „konkreten Anhaltspunkte“ für eine Benachteiligung, die durch die Betroffenen unabwendbar sein muss, vorliegen (Fn. 108, 110 ff.). Mit der Betrachtungsweise des Gerichts hierhingehend wurde sich bereits unter (II.) auseinandergesetzt. Folgt man dem Gericht in seiner Argumentation, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf staatlichen Schutz („ob“).
Die staatlichen Organe entscheiden in diesem Fall jedoch grundsätzlich in eigener Verantwortung, wie sie diese Schutzpflichten erfüllen (vgl. BVerfGE 56, 54, 80 f. mwN). Dies umfasst alle denkbaren staatlichen Handlungsformen und damit auch exekutives handeln. Dass das Gericht die Erfüllung der Schutzpflicht an den (Parlaments-)Gesetzgeber (d.h. die Legislative) delegiert, stellt somit eine Einschränkung dieses grundsätzlich freien Ausgestaltungsrechts des Staates dar. Die Begründung für diese Einschränkung findet sich bereits in der früheren Rechtsprechung des Verfassungsgerichts: „Die Aufstellung und normative Umsetzung eines solchen Schutzkonzepts ist Sache des Gesetzgebers“ (BVerfGE 88, 203 (261)).
Hierin kann man eine gewisse Parallele zur Wesentlichkeitstheorie als besondere Ausprägung des Vorbehalts des Gesetzes sehen, nach der „alle wesentlichen Entscheidungen“, die „grundlegende normative Bereiche“ berühren, durch den Parlamentsgesetzgeber geregelt werden müssen (BVerfGE 49, 89). Insbesondere Entscheidungen, die zu einem nicht unerheblichen Grad Grund- und Gleichheitsrechte betreffen, sind wesentlich (v. Mangoldt/Klein/Sommermann, 2018, GG, Art. 20, Rn. 276 ff. mwN). Die Wesentlichkeitstheorie greift im Unterschied zur vorliegenden Konstellation jedoch dann ein, wenn eine Grundrechtseinschränkung, die nur vom Parlament vorgenommen werden darf, aktiv von der Exekutive getroffen wurde (dies entspräche einer Verletzung eines Abwehrrechts und nicht einer Schutzpflicht, vgl. BVerfGE 98, 218).
Abgesehen von der erläuterten organschaftlichen Einschränkung steht dem Gesetzgeber ein „weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu“ (Rn. 99). Dessen Grenzen, die durch das Gericht (teilweise) bereits abgesteckt wurden, finden sich in der Verfassung (das ergibt sich bereits aus Art. 20 Abs. 3 GG; vgl. überdies BVerfGE 88, 203 (261 f.)).
Aus alle dem leitet sich eine überaus simple Subsumtion ab: Der Gesetzgeber hätte die Materie regeln müssen, tat dies aber nicht (vgl. Rn. 122). Eine Schutzpflichtverletzung liegt vor.
4. Fazit
Aus rechtlicher Sicht ist die Entscheidung (im Unterschied zu ihrer medialen Präsentation) meines Erachtens weder überaus überraschend noch revolutionär. Der dem Bundesverfassungsgericht häufig gemachte Vorwurf des Juristischen Aktivismus bzw. des judicial activism steht aus meiner Sicht bei dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht im Raum. In vielerlei Hinsicht gibt das Gericht den Stand der ethischen Diskussion in Deutschland wieder. Die aufgezeigten „roten Linien“ des Verfassungsrechts sind zumindest für einen sehr breiten Teil der Gesellschaft ohnehin selbstverständlich; auch die Stellungnahmen verschiedener Fachgremien waren sich in diesen Punkten einig. Dass die Triage gesetzlich geregelt werden sollte, ist überdies bereits seit fast zwei Jahren immer wieder im gesellschaftlichen wie auch im fachjuristischen Diskurs gefordert worden, der Gesetzgeber ist dennoch untätig geblieben. Die Umsetzung einer gesetzlichen Lösung scheiterte kaum an verfassungsrechtlichen Fragestellungen – der Gesetzgeber wäre selbst bei einer anders ausgefallenen Entscheidung nicht davon abgehalten gewesen, die Triage trotz allem zu regeln – sondern vor allem an dem politischen Unwillen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen; die Untätigkeit des Gesetzgebers hat die Ängste und Unsicherheiten von vulnerablen Gruppen und Medizinerinnen und Medizinern in einem Moment der Verletzlichkeit kommentarlos passieren lassen. Selbst wenn die gesetzliche Regelung für sich nicht die strukturellen Probleme im medizinischen System lösen kann, so birgt sie vor allem auch die Chance der Einheitlichkeit und der Rechtssicherheit für Entscheidungsträger. Nun gilt es zu hoffen, dass der Gesetzgeber (anders als nach der Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB) seinem Auftrag gemäß unverzüglich tätig wird.