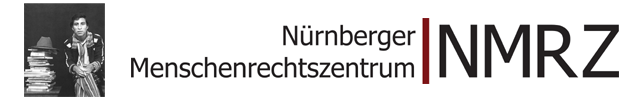von Rainer Huhle
Überlegungen zur staatlichen Schutzpflicht vor Menschenrechtsverletzungen und zum Staatsmonopol auf Menschenrechtsverletzungen [1]
“Nun stellte sich plötzlich heraus, daß in dem Augenblick, in dem Menschen sich nicht mehr des Schutzes einer Regierung erfreuen, keine Staatsbürgerrechte mehr genießen und daher auf ein Minimum an Recht verwiesen sind, das ihnen angeblich eingeboren ist, es niemanden gab, der ihnen dies Recht garantieren konnte, und keine staatliche oder zwischenstaatliche Autorität bereit war, es zu beschützen.“
Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen, kann durchaus spannend sein. Worauf bezieht sich wohl diese beredte Klage? Auf die Menschen, die unter warlords in Sierra Leone oder im Kongo massakriert werden, ohne daß ein Weltpolizist einschritte? Auf die indigenen Völker, die jahrelang in entlegenen Urwaldgebieten Perus vom “Leuchtenden Pfad“ versklavt wurden, ohne daß ihr Schicksal groß kümmerte? Auf die indischen Bauern, die in weiten Teilen des Subkontinents von kriminellen Banden ausgesaugt oder von nationalistischen Geheimbünden gemordet werden, ohne daß sich ein Richter dafür interessierte?
Nun, die im Zitat gemeinte Situation liegt etwas länger zurück, “als immer mehr Menschen und immer mehr Volksgruppen erschienen, deren elementare Rechte als Menschen wie als Völker im Herzen Europas so wenig gesichert waren, als hätte sie ein widriges Schicksal plötzlich in die Wildnis des afrikanischen Erdteils verschlagen.“ Ist also von den Bosnienflüchtlingen die Rede, die niemand haben will? Auch deren Schicksal würde sicher auf die beklagte Lücke im Menschenrechtsschutz zutreffen. Gemünzt war der Satz seinerzeit jedoch von Hannah Arendt in ihrem Buch “Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“ auf die “Nation der Minderheiten“ und das “Volk der Staatenlosen“, die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs das nationalstaatliche Gefüge Europas – und ihrer Meinung nach zugleich die Idee der Menschenrechte als Bürgerrechte – grundsätzlich in Frage stellten.
Hannah Arendt denunzierte hier das Versagen der Nationalstaaten, die Menschenrechte von Personen zu gewährleisten, die im wesentlichen auf Grund eben der Politik dieser Nationalstaaten in ihre Situation der Schutzlosigkeit geraten waren. Dabei ist die von ihr als grundsätzliches theoretisches Problem gesehene “Aporie der Menschenrechte“ aus heutiger Sicht so nicht mehr gegeben. Das Völkerrecht hat in der Nachkriegszeit eine Reihe allgemeiner Prinzipien und spezifischer Instrumente geschaffen, die Minderheitenrechte sehr weitgehend, die Rechte von Staatenlosen weniger umfangreich, aber immerhin auch explizit im ersten Zusatzprotokoll der Genfer Konventionen und indirekt im Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung und in verschiedenen Bestimmungen zur Sicherung der Rechte der Kinder schützen.
Wie aber steht es mit den Rechten der Personen, die nicht auf Grund des Handelns der Staaten, sondern wegen der Verfolgung durch politische, religiöse, wirtschaftliche oder einfach kriminelle Gruppen in der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte bedroht sind? Den oben genannten Beispielen ließen sich ja, wie ein beliebiger Blick in die Weltpresse zeigt, leicht viele weitere hinzufügen, in denen Menschen Opfer von unterschiedlich großen und mächtigen Gruppen werden, ohne auf die Hilfe ihrer eigenen oder der Staaten zählen zu können, in denen sie sich aufhalten. Wer garantiert deren Rechte? Und an wen können sich die Opfer wenden, um ihre Beschwerden vorzutragen, Abhilfe und schließlich Entschädigungen zu verlangen?
Die staatliche Verantwortung für die Menschenrechte
Auf den ersten Blick scheint die Antwort einfach. Zuständig sind wiederum die Staaten. Als Inhaber des Monopols legitimer Gewaltausübung sind sie verpflichtet, dieses auch gegenüber allen denkbaren Personen und Gruppen durchzusetzen und ihre Bürger gegenüber illegitimen Angriffen dieser Gruppen zu schützen. In der Praxis jedoch bestehen eben zahlreiche Situationen, in denen der Staat dieser seiner Pflicht nicht nachkommt. Grundsätzlich sind hier zwei Szenarien zu unterscheiden, die beide weit verbreitete traurige Realität sind.
Im einen Fall begehen die Täter ihre Übergriffe in offener oder heimlicher Komplizenschaft mit dem Staat oder einzelnen seiner Organe. Hierzu zählen die Aktionen paramilitärischer Banden in Kolumbien oder polizeilich gedeckter Todesschwadronen in Brasilien ebenso wie Hungerlöhne, Kinderarbeit oder gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen in chinesischen oder indischen Unternehmen, bei denen die staatlichen Aufsichtsbehörden beide Augen zudrücken. In diesen Fällen ist die Rechtslage klar. An der staatlichen Verantwortlichkeit für Menschenrechtsverletzungen ändert sich absolut nichts, wenn die Menschenrechtsverletzungen nicht von seinen eigenen Beamten, sondern von Dritten begangen werden, deren Taten vom Staat unterstützt, gedeckt oder systematisch geduldet werden. Die zuständigen internationalen Menschenrechtsorgane sowohl in Europa wie in Amerika haben hierzu unmißverständliche Urteile gefällt. Für die Opfer solcher Verletzungen steht damit der gleiche Rechtsweg offen wie bei direkten staatlichen Menschenrechtsverletzungen. Nach Ausschöpfung der nationalen Instanzen können die regionalen Menschenrechtsgerichtshöfe oder die entsprechenden Ausschüsse der Vereinten Nationen (UN) angerufen werden.
Die Privatisierung von Krieg und Sicherheit
Allerdings gibt es hier wachsende Grauzonen unkontrollierter Gewaltausübung, in denen sich auf schwer durchschaubare Weise die politischen Interessen verschiedener Staaten und die wirtschaftlichen Interessen eben dieser Staaten, aber auch nationaler und internationaler Unternehmen verbinden. Private Sicherheitsdienste nehmen in vielen Ländern angesichts wachsender unkontrollierter Kriminalität explosionsartig zu. Im Phänomen internationaler Söldnertruppen schließlich, wie sie seit Jahren besonders, aber keineswegs ausschließlich, in Afrika agieren, vermengen sich auf beunruhigende Weise Menschenrechtsverletzungen einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung mit Verletzungen des klassischen völkerrechtlichen Prinzips der Staatensouveränität und Verletzungen des Kriegsvölkerrechts, das verdeckte militärische Aktionen verbietet. Das Anwachsen dieser Söldneraktivitäten bewog die UN bereits 1987 zur Ernennung eines Sonderberichterstatters “über den Einsatz von Söldnern als Mittel der Verletzung der Menschenrechte und des Rechts auf Selbstbestimmung der Völker“.
Der Sonderberichterstatter besteht in seinen Berichten angesichts einer wachsenden Tendenz zur Ausrüstung privater Armeen auf der Verantwortlichkeit der Regierungen für die Sicherheit ihrer Länder und natürlich die Respektierung der Sicherheit anderer Staaten, und warnt vor den Gefahren dieser Entwicklung, die z.B. in den Diamantenkriegen in Westafrika überdeutlich geworden sind. Leider ist das kaum bekannte “internationale Abkommen von 1989 gegen die Rekrutierung, den Einsatz, die Finanzierung und das Training von Söldnern“ bis heute nicht von der nötigen Mindestzahl von Staaten ratifiziert worden und damit noch immer nicht in Kraft. Zu den Regierungen, die sich gegen eine stärkere Bekämpfung des Söldnerunwesens durch die UN-Menschenrechtskommission (MRK) sperren, gehört z.B. die britische, auf deren Territorium bekanntlich einige der größten international operierenden Söldnerorganisationen ihren Sitz haben. Aber auch Deutschland und die EU-Staaten sowie die USA wandten sich in der MRK im Frühjahr 2000 gegen eine Behandlung des Themas und verlangten sogar eine Beendigung der Tätigkeit des Sonderberichterstatters.
Söldner werden sowohl von Regierungen wie von aufständischen Organisationen eingesetzt. In beiden Fällen stehen den betroffenen Bevölkerungen in der Praxis keine Rechtsmittel zur Verfügung, um sich gegen die Menschenrechtsverletzungen durch diese Söldnerheere zu wehren. So weit diese auf Regierungsseite kämpfen, tun sie das verdeckt wie andere paramilitärische Verbände auch. Stehen sie auf der Seite von Aufständischen, sind die Opfer genauso schutzlos. Wenn die Menschenrechte nicht von Angehörigen des Staates oder mit ihnen verbündeten Kräften verletzt werden, sondern von oppositionellen Personen und Gruppen, also z.B. von einer aufständischen Guerilla, steht der Staat nach der klassischen Doktrin, die ihn zum allumfassenden Garanten der Menschenrechte und Inhaber des legitimen Gewaltmonopols erklärt, zwar ebenfalls in der Verantwortung, die Menschen zu schützen, und er sollte aus dieser Verantwortung auch nicht entlassen werden. Nur liegt auf der Hand, daß entsprechende Vorhaltungen in den meisten Fällen schon deswegen wenig erfolgversprechend sind, weil der Staat längst aus eigenem Interesse versucht hat, gegen die Aktionen der Guerilla vorzugehen – und dabei in aller Regel selbst Menschenrechtsverletzungen in einem “schmutzigen Krieg“ begeht. Wenn seine Polizei, seine Gerichte und selbst seine Armeen nichts ausrichten, welchen Sinn soll es für die Opfer dann haben, sich wegen der Verletzung ihrer Rechte durch die Gegner des Staates an eben diesen zu wenden?
Die Schutzlosigkeit der Opfer von nichtstaatlichen Gruppen
Ebensowenig wird es möglich sein, gegen den Staat in solchen Fällen vor den internationalen Instanzen etwas zu erreichen. Zwar ist die Pflicht der Staaten, die Menschenrechte auch gegenüber Verletzungen durch Dritte zu garantieren, durchaus in der Rechtsprechung anerkannt. Sie wird jedoch nicht in erster Linie am Erfolg, sondern an der Bemühung gemessen. Nach allgemeiner und vernünftiger Auffassung kommt ein Staat dieser Pflicht nach, wenn er sich ernsthaft um Schutz bzw. Abhilfe bemüht. Keine Regierung wird der Menschenrechtsverletzung beschuldigt, wenn sie gegen einen folternden Polizisten energisch durchgreift und Vorkehrungen trifft, daß sich der Fall nicht wiederholt. Im Fall von länger andauernden Guerillaaktivitäten, die Grundrechte der Bevölkerung verletzen, wird es dem Staat in der Regel weit leichter fallen, seine Versuche zur Bekämpfung der Täter nachzuweisen, auch wenn sie erfolglos bleiben. Die Doktrin von der Staatenverantwortlichkeit greift in diesen Fällen also zumindest praktisch ins Leere.
Es ergibt sich somit die paradoxe, darum für die Betroffenen nicht weniger bittere Situation, daß die Opfer von Menschenrechtsverletzungen unter Umständen gegenüber dem Staat bessere Schutzmöglichkeiten haben, als wenn es sich um nichtstaatliche Täter handelt. Dies hat mit einem weiteren Paradox zu tun, daß nämlich in diesen Fällen zwar eine Tat, aber kein Täter vorhanden zu sein scheint. Wenn eine Guerillagruppe ein Dorf überfällt, dabei Zivilisten tötet, die sie für politische Gegner hält, und wenn dann zwei Tage später die Armee einrückt und das gleiche tut, so ist zwar an beiden Tagen das elementare Menschenrecht auf Leben verletzt worden, eine Menschenrechtsverletzung hat aber nach der klassischen Doktrin nur die Armee als Organ des Staates begangen. Die Morde der Guerilla hingegen gelten als Verbrechen nach dem Strafgesetzbuch oder auch, wenn man den Konflikt insgesamt als kriegerische Auseinandersetzung ansieht, als Verletzungen des humanitären Völkerrechts.
Können Menschenrechte nur von Staaten verletzt werden?
Das zuletzt genannte Beispiel führt mitten hinein in eine gewichtige Streitfrage in der Menschenrechtsdiskussion, die zwar oft als theoretische Diskussion über rechtsdogmatische Standpunkte geführt wird, zugleich aber weitreichende politische Konsequenzen mit sich bringt. Es gibt gute Gründe dafür, daß die meisten Theoretiker und Praktiker der Menschenrechtsidee den Begriff der “Menschenrechtsverletzung” für das Verhältnis Bürger/Staat reserviert sehen wollen. Die Termini “Menschenrechte” bzw. “Menschenrechtsverletzung” sind, zumindest in der westlichen Tradition, historisch aus dem Kampf der Bürger um ihre rechtliche Emanzipation gegenüber dem Staat entstanden. Sie sind in dieser Tradition an die Idee des Rechtsstaats mit seinem Gewaltmonopol und seiner Verantwortlichkeit als Garant der Bürgerrechte gebunden. Dem Monopol legitimer Gewalt entspricht dann gewissermaßen auch ein Staatsmonopol auf Menschenrechtsverletzung als dem Mißbrauch dieser legitimen Gewalt. Aus dieser Perspektive macht die Unterscheidung staatlichen oder staatlich zu verantwortenden Handelns von privaten Rechtsverstößen ihren guten Sinn.
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wie auch in den entsprechenden Grundrechtskatalogen der nationalen Verfassungen oder in den regionalen und internationalen Menschenrechtspakten werden andererseits die Menschenrechte als grundsätzliche Rechte formuliert, ohne daß dabei die möglichen Verletzer auf bestimmte Täterkreise eingeschränkt würden. Alles andere wäre auch widersinnig. Denn aus der Perspektive der Betroffenen, der Opfer von Menschenrechtsverletzungen, ist es zunächst unerheblich, wer der Täter ist. Der Verlust für eine Familie, wenn ein Angehöriger ermordet wird, ist der gleiche, egal ob die Täter gewöhnliche Kriminelle, Polizisten oder Rebellen sind. Und in jedem Fall handelt es sich um eine Verletzung des elementaren Menschenrechts auf Leben. Dies sollte schon aus Respekt vor dem Leid der Opfer nicht relativiert werden.
Dennoch ist, wenn es um die Qualifizierung des Geschehenen als Menschenrechtsverletzung geht, entscheidend, in welchem Kontext die Tat geschah, was ihr voranging und was nach der Tat geschah. Menschenrechtsschutz kann, so lange das Zufügen und Erleiden von Aggression Teil menschlichen Verhaltens ist, nicht als Garantie gegen jegliche Verletzung von Menschenrechten begriffen werden, sondern als ernsthafter Versuch, sie zu unterbinden und ihnen vorzubeugen. Menschenrechtliche Kritik setzt also üblicherweise erst dann ein, wenn eine systematische und andauernde Verübung, Förderung oder Duldung von Verletzungen der Menschenrechte zu beobachten ist. Die Differenz liegt dabei nicht in der Statistik und ist auch keineswegs abstrakter Natur. Für die Opfer macht es einen entscheidenden Unterschied, ob die Gesellschaft – und die staatlichen Instanzen sind hier ihr verbindlichster Sprecher – den Schmerz und die Entrüstung über die Tat und die Täter teilt oder ob sie sich eher als deren Komplize zeigt. Zu Recht bezeichnen in diesem Sinn Menschenrechtsorganisationen die systematische Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen als eine weitere Verletzung, die an den Opfern begangen wird. Wo den Betroffenen hingegen ein effektiver Rechtsweg offen steht, der zur Ermittlung der Wahrheit, zur Verurteilung der Täter und zur Rehabilitation und Entschädigung der Opfer führt, werden die individuellen wie gesellschaftlichen Folgen der Verletzung in bedeutsamer Weise gemildert.
Gleicher Schutz für alle Opfer
Gerade diese Möglichkeit ist aber in den Fällen so gut wie nie gegeben, in denen nichtstaatliche Gruppen Menschenrechte verletzen. Der Staat kann oder will sie nicht kontrollieren, und sie selbst sind zur Anerkennung ihrer Verantwortlichkeit nicht bereit. Die Opfer befinden sich somit in einer Situation besonderer Hilf- und Schutzlosigkeit. Häufig betrachten sie in solchen Situationen Schweigen als einzig mögliche Strategie. Die Einhaltung dieser “omertí “, wie das erzwungene Schweigen bei der italienischen Mafia genannt wird, ließ sich in Peru zu Zeiten der regionalen Machtentfaltung des “Leuchtenden Pfads“ ebenso beobachten wie heute in weiten Gebieten Kolumbiens oder in anderen Regionen, wo die Bevölkerung in dem Bewußtsein lebt, daß eine Beschwerde oder gar Anzeige des erlittenen Unrechts zu nichts führt außer zu mehr Leid und Unrecht. Wenn in solchen Situationen dann auch von Menschenrechtsorganisationen zu hören ist, daß sie nicht zuständig sind, weil es sich um keine Menschenrechtsverletzung im eigentlichen Sinn handle, dann fühlen sich die Opfer nicht nur selbst nicht ernst genommen, sie nehmen auch die Idee der Menschenrechte nicht mehr ernst. Denn aus ihrer Perspektive sind nicht schwierige rechtliche Probleme, sondern einfach nur ein doppelter Maßstab für gleiches Leid erkennbar.
Viele Menschenrechtsorganisationen wie etwa amnesty international oder Human Rights Watch haben dies längst erkannt. Sie können zwar das reale Dilemma nicht aus der Welt schaffen, daß es oft nicht einmal Kommunikationskanäle für Beschwerden an Rebellenorganisationen gibt, und daß diese in der Regel die völkerrechtlichen Regeln des Menschenrechtsschutzes für sich nicht anerkennen. Doch schon die Berichterstattung auch über die Übergriffe solcher Organisationen gegen die Bevölkerung in Gebieten ihres Einflusses oder ihrer Kontrolle schafft nicht nur die Voraussetzung für ein objektiveres Gesamtbild, sondern auch ein Stück zumindest moralischer Gerechtigkeit für die Betroffenen. Zugleich erhöht sie die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtsorganisationen als unabhängiger Beobachter und damit, da Glaubwürdigkeit ihr wesentliches Kapital ist, auch ihre Effektivität.
Die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts
So weit sich die Menschenrechtsverletzungen, gleich durch wen, im Rahmen von bewaffneten Konflikten im Sinn der Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle abspielen, sind sie nach inzwischen weithin anerkannter Ansicht durchaus auch völkerrechtlich faßbar, nämlich als Kriegsverbrechen. Hier entfällt, anders als im Fall der Menschenrechte, die Frage, ob ein Akteur als Vertragssubjekt gebunden ist oder ob nichtstaatliche Gruppen, da sie ja die Menschenrechtsabkommen weder unterzeichnet haben noch unterzeichnen können, daran auch nicht gebunden sind. Denn das humanitäre Völkerrecht ist geltendes Recht für alle Konfliktparteien, auch wenn sie die Genfer Konventionen nicht unterzeichnet haben. Viel gewonnen ist damit allerdings so lange nicht, als lediglich Tatbestände als Kriegsverbrechen definiert, aber weder Verfahrenswege zur Untersuchung und Abhilfe (sieht man einmal von der zahnlosen “International Fact-Finding Commission“ nach dem 1. Zusatzprotokoll ab) noch Instanzen für Sanktionen in Kraft sind.
Gleichwohl ist es notwendig, auch an die Aktionen von aufständischen Gruppen die Mindestnormen des humanitären Völkerrechts anzulegen, das ja den Aufstand als solchen und die damit verbundenen Gewaltakte nicht grundsätzlich verurteilt. Zumindest perspektivisch ist damit auch die Sanktion von Verletzungen des humanitären Völkerrechts gegeben, wie sie in eindeutiger Weise schon das erste der “Nürnberger Prinzipien“ von 1950 festschrieb: “Jede Person, die eine Tat begeht, die nach dem Völkerrecht als Verbrechen bestimmt wurde, ist dafür verantwortlich und wird der Bestrafung zugeführt.“
In dieser Linie bewegte sich auch die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC), wenn sie ausdrücklich den legitimen Charakter des bewaffneten Aufstands gegen das Apartheidregime anerkannte, aber gerade deswegen darauf bestand, daß es in diesem legitimen Kampf eine Reihe illegitimer Kampfmethoden gegeben hatte, die sie detailliert benannte und zu denen sie z.B. das Legen von Bomben ohne kontrolliertes militärisches Ziel rechnete. Wenn sie solcher Methoden beschuldigt wurden, mußten sich daher auch die Angehörigen des letztlich siegreichen ANC (African National Congress) vor der TRC rechtfertigen. Daß sich der regierende ANC nach längerem Zögern auf diese Verfahrensweise einließ, stärkte das Ansehen der TRC als objektiver Instanz und gehört zu den wegweisenden Elementen dieser Kommission.
Menschenrechtsverstöße oppositioneller Gruppen im UN-System
Im internationalen Bereich gibt das humanitäre Völkerrecht also zwar eine klare Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Aktionen nichtstaatlicher Gruppen – freilich nur, so weit sie im Rahmen bewaffneter Konflikte stattfinden –, doch existieren bislang kaum praktische Möglichkeiten der Sanktionierung. Die verschiedenen Mechanismen des UN-Systems zur Beobachtung, Kritik und Sanktion von Verstößen gegen das menschenrechtliche Völkerrecht (etwa die Komitees der beiden Menschenrechtspakte, der Kinderkonvention oder der Anti-Folter-Konvention, oder die MRK) sind nach wie vor auf das ausschließliche Prinzip der Staatenverantwortung zugeschnitten. Seit Anfang der neunziger Jahre gab es in der MRK eine Reihe von Anträgen, daß die Kommission auch die Taten von Rebellengruppen in ihre Berichte einbeziehen solle. Da solche Vorstöße aber gerade von solchen Regierungen wie Peru oder Kolumbien kamen, die wegen massiver Menschenrechtsverstöße in der MRK kritisiert wurden, war das rein taktische Interesse dieser Anträge leicht zu erkennen. Mit dem Verweis auf die Verbrechen eines Sendero Luminoso oder anderer aufständischer Gruppen sollten die eigenen Repressionsmethoden relativiert und letztlich entschuldigt werden.
Zu Recht weigerte sich die Kommission, auf dieses Spiel einzugehen. Gerade die MRK als Organ von Regierungsvertretern ist in besonderer Weise der Überwachung der Staatenverantwortlichkeit im Menschenrechtsschutz verpflichtet. Ohnehin sind ihre Resolutionen und Beschlüsse schon häufig mehr von politischen Kompromissen als von objektiver Auslegung der Menschenrechtsnormen geprägt. Wäre auch noch das Verhalten der Gruppen, die in Opposition zu den in der MRK vertretenen Regierungen stehen, Gegenstand ihres Mandats, würde das Tor zu einer vordergründigen Politisierung der Kommission noch weiter geöffnet. Das muß jedoch kein Hindernis dafür sein, daß in den von der MRK angenommenen Berichten, beispielsweise der Sonderberichterstatter, das Handeln der aufständischen Gruppen, wenn es zu einem objektiven Gesamtbild dazu gehört, mit einbezogen wird.
Bei den UN-Organen, die mit dem Anspruch von unabhängigen Experten arbeiten und deren Berichte jedenfalls keiner unmittelbaren Kontrolle durch Regierungen unterliegen (das Hochkommissariat, die Komitees der Pakte sowie die Sonderberichterstatter und speziellen Arbeitsgruppen) ist die Gefahr des politischen Mißbrauchs durch die Beschäftigung auch mit nichtstaatlichen Gruppen geringer anzusetzen. Sie können sich zumindest bei der Berichterstattung auch teilweise bereits auf ein ausdrückliches Mandat berufen und machen dabei gute Erfahrungen, wie etwa im Fall des Kolumbienbüros der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Gleichwohl sind auch sie in ihrer Arbeit an das bestehende Menschenrechtsvölkerrecht gebunden, das nach wie vor im wesentlichen ein Recht der Staatenverantwortlichkeit ist.
Sehr deutlich wird das beispielsweise bei der Anti-Folter-Konvention von 1984, einem der fortschrittlichsten und effektivsten Menschenrechtsinstrumente, auf dessen Grundlage u.a. die Londoner Richter sich für die Auslieferung von General Pinochet entschieden. Als Folter gelten dieser Konvention ausdrücklich nur solche Handlungen, die “von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden.“ Was auf den ersten Blick widersinnig erscheinen mag, als ob es für ein Folteropfer einen Unterschied machte, wer ihm mit welcher Absicht Qualen zufügt, ist im Hinblick auf die Intention der Konvention, nämlich die weltweit verbreitete staatlich sanktionierte Folterpraxis zu unterbinden, eine notwendige definitorische Einschränkung. Andererseits bleibt dadurch ganz offensichtlich ein Teil von Verstößen gegen das Recht auf Unversehrtheit, eben die durch nichtstaatliche Gruppen begangenen Mißhandlungen, unerfaßt und dem einfachen Strafrecht der Staaten überlassen.
Ein Dilemma des Völkerrechts
Das hier sichtbare Dilemma des Völkerrechts ist ein echtes und läßt keine einfachen Lösungen zu. In langen Jahrzehnten wurde ein System völkerrechtlichen Menschenrechtsschutzes auf UN- und regionaler Ebene aufgebaut, das in der Tradition des klassischen Staats- und Verfassungsrechts auf der Verantwortlichkeit der Staaten für die Garantie der Menschenrechte beruht und an eben diese appelliert. Auf Entwicklungen, wie sie in anderem Kontext schon Hannah Arendt diagnostizierte und wie sie heute in anscheinend wachsenden Teilen der Welt zu beobachten sind, wo große Bevölkerungsgruppen unter der Herrschaft aufständischer Gruppen oder unkontrollierter warlords leben, ist dieses Rechtssystem nicht ausgerichtet. Die üblichen, meist ohnehin recht schwachen Kontrollmechanismen der “internationalen Staatengemeinschaft“ auf der Basis des Völkerrechts greifen nicht. Die Forderungen, die UN oder regionale Systeme sollten die Menschenrechtsverletzungen solcher nichtstaatlicher Akteure in gleicher Weise behandeln wie staatliche Verletzungen, stößt schnell ins Leere. Zum einen schrecken die gleichen Staaten, die solche Forderungen erheben, vor der damit zumindest politisch verbundenen Aufwertung der betreffenden Gruppen als Teilnehmer des diplomatischen Spiels zurück. Im übrigen steht der “Staatengemeinschaft“ außer dem letzten Mittel der kriegerischen Intervention bisher kein entwickeltes Instrumentarium im Umgang mit diesen Gruppen zur Verfügung. Auf dem Gebiet, wo internationale Intervention den betroffenen Menschen die direkteste Hilfe böte, nämlich bei der humanitären Hilfe, erweist sich zudem, daß viele Regierungen ihre Forderung nach Gleichstellung von terroristischen Gruppen und staatsterroristischen Menschenrechtsverletzungen selbst nicht ernst nehmen. Nur so ist zu erklären, daß bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die vor nichtstaatlicher Diskriminierung und Verfolgung geflohen sind, entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention plötzlich wieder ganz die klassische Lehre vom Staat als einzigem Urheber von Menschenrechtsverletzungen bzw. politischer Verfolgung zu Wertschätzung gelangt. So werden Opfer religiöser oder geschlechtsspezifischer Verfolgung – z.B. 1997 vom Bundesverwaltungsgericht im Fall der afghanischen Taliban – aus der Gruppe politisch Verfolgter herausdefiniert und der Zuflucht beraubt.
Gerade in diesem Zusammenhang könnte allerdings der künftige Internationale Strafgerichtshof (IStGH) bedeutsam werden. Während auf der Ebene des menschenrechtlichen Völkerrechts, das als Vertragspartner und Adressaten die Staaten hat, die nichtstaatlichen Akteure nur schwer in die Verantwortung zu nehmen sind, geht das internationale Strafrecht seit dem Nürnberger Militärtribunal vom Prinzip der individuellen Verantwortlichkeit aus. Dieses aber ist im Prinzip genauso auf staatliche Funktionsträger wie auf Angehörige nichtstaatlicher Gruppen anwendbar. So definiert das Statut des künftigen Gerichtshofs die “Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ auch nicht ausdrücklich als Staatsverbrechen. Anders als die Anti-Folter-Konvention definiert das Statut des IStGH als “Folter” schlicht den “Umstand, daß einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des Beschuldigten befindlichen Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden,“ und in der Definition des Tatbestands des “Verschwindenlassens von Personen” ist sogar ausdrücklich “ein Staat oder eine politische Organisation“ als in Frage kommender Täter genannt (Artikel 7). Wie diese Bestimmungen letztlich vom Gerichtshof ausgelegt werden, ist noch nicht abzuschätzen. Ein anderer internationaler Strafgerichtshof jedenfalls, das in Arusha tagende Ruanda-Tribunal der UN, hat mit der Anklage von Geschäftsleuten, Journalisten und Pastoren wegen der Beteiligung am Völkermord, auch wenn es sich dabei um Privatleute auf Seiten der damaligen Regierungsmehrheit handelte, einen interessanten Präzedenzfall dafür gesetzt, daß die Ahndung solcher Verbrechen nicht auf Staatsfunktionäre beschränkt bleibt.
Schlußfolgerungen
Wesentliches Problem bei der Frage nach dem Umgang mit Menschenrechtsverletzungen durch nichtstaatliche aufständische oder andere Gruppen ist, daß die gleichermaßen begründeten Ansprüche der Opfer auf Sanktionierung der an ihnen verübten Verletzungen ihrer elementaren Rechte und die Anforderungen an eine überprüfbare und sanktionierbare Staatenverantwortlichkeit nicht vollständig zu vereinbaren sind. Wege aus dieser Schwierigkeit könnten sein:
- Ein umfassendes Monitoring von Menschenrechtsverletzungen aller Täter, wobei die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von Staaten und nichtstaatlichen Gruppen nicht verwischt werden sollten. Insbesondere die nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen sollten sich, wie sie es teilweise schon tun, offensiv dieser Herausforderung stellen, um ihrer Glaubwürdigkeit willen, aber auch, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Deren Stimme sollte mehr als bisher gehört werden.
- Die bestehenden Ansätze im UN-System und in den regionalen Menschenrechtsschutzsystemen zur Einbeziehung von bewaffneten Oppositionsgruppen als Adressaten menschenrechtlicher Forderungen sollten verstärkt werden. Die auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts (“humanitäre Abkommen“) gemachten Schritte könnten, auch wenn sie noch nicht sehr ermutigend sind, als Basis dienen. Die damit möglicherweise verbundene politisch-diplomatische Aufwertung der bewaffneten Gruppen sollte mehr als Chance denn als Problem erkannt werden.
- Die internationale Bekämpfung von Söldnergruppen, Sicherheitsdiensten und Waffenhandel als Quelle vieler nichtstaatlich begangener Menschenrechtsverletzungen sollte verstärkt werden.
- Das Völkerstrafrecht sollte, auf Grundlage des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und der Genfer Konventionen, auch gegenüber Angehörigen nichtstaatlicher Gruppen konsequent angewandt werden.
Literaturhinweise:
Chr. Much: Nichtstaatliches Unrecht, in: G. Baum/E. Riedel/M. Schaefer (Hg.): Menschenrechtsschutz in der Praxis der Vereinten Nationen, Baden-Baden 1998, S. 279-294;
R. Nair: Confronting the Violence Committed by Armed Opposition Groups, in: Yale Human Rights & Development Law Journal 2 (1998);
Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofes (Auszüge), in: Jahrbuch Menschenrechte 2000, S. 353-370;
K. Wiesbrock: Internationaler Schutz der Menschenrechte vor Verletzungen durch Private, Berlin 1999.
[1] Dieser Beitrag erschien im „Jahrbuch Menschenrechte 2002“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2001